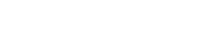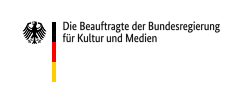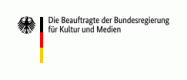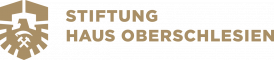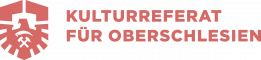Unser Service für die Medien:
Hier finden Sie unsere Presseinformationen zu den Sonderausstellungen und weiteren Veranstaltungen.
In unserem Downloadcenter stellen wir Ihnen hochaufgelöste Pressefotos und das aktuelle Programmheft zum Herunterladen zur Verfügung.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns an.

Katarzyna Lorenc M.A.
Kommunikation und Marketing
E-Mail: lorenc@oslm.de
Fon: +49 (0) 21 02 – 965 233
Der Vorverkauf läuft! Unter der Überschrift „Europakonzert der Schlesischen Philharmonie. UNESCO trifft UNESCO“ lädt das Oberschlesische Landesmuseum in Kooperation mit der Stiftung Zollverein zu einem Konzert ein, das den 20. Jahrestag des Beitritts Polens zur EU würdigt und zugleich als musikalischer Auftakt zur neuen Sonderausstellung des Ratinger Museums dient.
Die Konzertbesucher erwartet eine exquisite Kombination traditioneller Musikformen mit Werken von J. S. Bach und zeitgenössischen Kompositionen wie dem „Silver Concerto“ mit Industrieklängen sowie Ton- und Filmaufnahmen aus dem Historischen Silberbergwerk in Tarnowitz (Tarnowskie Góry). Durch den Abend führt Adam Wesołowski, Direktor und Dirigent der 1945 in Kattowitz (Katowice) gegründeten Philharmonie.
Die Veranstaltung findet am Samstag, den 4. Mai 2024 um 19 Uhr auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein statt. Die Tickets (zum Preis von 30 Euro bzw. 20 Euro ermäßigt) sind ab sofort online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Die Schlesische Philharmonie zählt nach Meinung vieler Kritiker zu den besten Klangkörpern Polens. Ihre Musikerinnen und Musiker begeistern durch außergewöhnliches Engagement und höchste Professionalität. Seit 2008 gehört die Schlesische Philharmonie zu einer Gruppe von Orchestern, die sich dem europäischen Projekt „An Orchestra Network for Europe – ONE step further“ angeschlossen haben.
Polen trat vor 20 Jahren, am 1. Mai 2004, zusammen mit Ungarn, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Estland, Litauen, Lettland, Zypern und Malta der Europäischen Union bei. Diese größte Erweiterung in der Geschichte der EU war ein Meilenstein für das Zusammenwachsen Europas.
Das Oberschlesische Landesmuseum freut sich, ein facettenreiches Spektrum an kulturellen Ereignissen für das zweite Quartal 2024 bekannt zu geben. Von fesselnden Vorträgen über kreative Workshops bis hin zu musikalischen Höhepunkten bietet das Museum ein breit gefächertes Angebot für Besucher jeden Alters.
Am 18. April um 18:30 Uhr präsentiert der renommierte Historiker Andreas Kossert sein neuestes Werk „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“. Für den 19. April um 17 Uhr lädt das Museum zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Form – Farbe – Licht“ von Anna Tatarczyk ein, die einen faszinierenden Einblick in das Schaffen der Künstlerin gewährt. Ein Highlight im Veranstaltungskalender ist das Europakonzert der Schlesischen Philharmonie auf Zeche Zollverein am 4. Mai um 19 Uhr, das Liebhaber klassischer und industrieller Musik begeistern wird. Am 5. Mai um 15 Uhr startet die Ausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“, die einen Einblick in die faszinierende Welt des Bergbaus in Oberschlesien bietet. Die Ausstellung beginnt mit einer thematischen Einführung mit geladenen Gästen. Während dieser Zeit wird für Kinder eine Betreuung angeboten. Für junge Besucher bietet das Oberschlesische Landesmuseum am 11. Mai von 14 bis 18 Uhr den samstäglichen Workshop unter der Überschrift „Fang das Licht ein – mit Draht und Silber“ an, das speziell für 10-14 Jährige konzipiert ist und vom Kulturrucksack NRW finanziert wird. Am 19. Mai feiert das Museum den Internationalen Museumstag mit einem vielfältigen Programm, darunter eine Entdeckerführung mit Dr. Marius Hirschfeld, ein Schreibworkshop mit Mariusz Hoffmann sowie eine Lesung aus seinem Debütroman „Polnischer Abgang“. Das Sommerfest am 15. Juni ab 11 Uhr lädt Besucher zu musikalischen Live-Acts, kreativen Workshops und abwechslungsreichen Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen ein. Am 22. Juni von 14 bis 16 Uhr lädt das Museum zum sommerlichen Atelier ein: Unter dem Motto „Sommer und Sonne“ werden Accessoires für die warme Jahreszeit hergestellt. Am 30. Juni endet die aktuelle Sonderausstellung über die preußischen Regimenter in der Provinz Schlesien zwischen 1871 und 1914 mit einer Führung und einem Gastvortrag von Carsten Reuß, wissenschaftlicher Referent des LWL-Preußenmuseums Minden.
Für einige Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Sichern Sie sich Ihren Platz rechtzeitig, indem Sie sich per E-Mail an vermittlung@oslm.de anmelden. Auf Anfrage können mehrsprachige (Deutsch, Polnisch, Englisch) Führungen gebucht werden, für Schulen und Universitäten sogar außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Optional kann auch ein anschließendes Kaffee- und Kuchenangebot arrangiert werden. Nicht zu vergessen sind auch die beiden Escape Rooms, die auf spielerische Art und Weise die Kultur und Geschichte Oberschlesiens vermitteln.
Am Donnerstag, den 18. April um 18.30 Uhr ist im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Litterae Silesiae“ der Historiker und Autor Andreas Kossert zu Gast im Oberschlesischen Landesmuseum. Er stellt sein Bestsellerbuch „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“ vor. Durch den Abend führt der Museumsdirektor Dr. David Skrabania. Der Eintritt ist frei.
Mit „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“ hat Andreas Kossert ein Kompendium geschaffen, das das Thema Flucht über Nationen hinweg betrachtet und aufzeigt, wie sich der Blick auf das Sujet im Laufe der Zeit politisch und sprachlich ändert. Zahlreiche Verweise auf Zeitungsartikel, Statements aus der Politik, Ego-Dokumente sowie auf literarische und lyrische Texte belegen, was bereits im Untertitel anklingt: Flucht ist bis heute eine Geißel der Menschheit. Das Spektrum der Recherche und die fachliche Expertise Kosserts, die sich hier offenbaren, fanden auch in der Rezeption des Buches Anerkennung, denn „Flucht“ wurde mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 und dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet.
„Im Mittelpunkt dieses Buches stehen Flüchtlinge, die aufgrund nationaler, religiöser oder ethnischer Verfolgung ihre Heimat verlieren. (…) Es geht um die Frage: Was bedeutet es für einen Menschen, Heimat für immer zu verlieren, unter Zwang und Gewalt fliehen zu müssen und am Ende im Exil zu leben? Wie lange währt nach dem Ankommen der transitorische Zustand im Exil, und ist er überhaupt zu überwinden? Heimatverlust ist für jeden Betroffenen eine fundamentale Zäsur, die das Leben in ein Davor und ein Danach teilt. Aus der Perspektive von Flüchtlingen zu erzählen, bedeutet, die Weltgeschichte anders zu sehen“ – heißt es bereits im Geleitwort und fasst das Spannungsfeld des Buches treffend zusammen. Ohne das geschichtspolitische Geschehen aus den Augen zu verlieren, integriert Kossert zahlreiche Einzelschicksale in seine Erzählstränge und erweist sich damit mit seiner mittlerweile achten Monografie nicht nur als ausgewiesener Kenner der Geschichte, sondern auch als einfühlsamer Autor.
Das Buch kann nach der Lesung vor Ort erworben werden, aber auch mitgebrachte Exemplare werden vom Autor signiert.
Mit einer Doppeleröffnung beginnt die kommende Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum. Neben der Vernissage am 5. Mai sorgt am Vorabend ein Europakonzert der Schlesischen Philharmonie aus Kattowitz auf der Zeche Zollverein für Aufmerksamkeit.
Die Sonderausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“ zeigt die Geschichte der einzigen UNESCO-Welterbestätte Oberschlesiens und damit des Bergbaus in Tarnowitz (Tarnowskie Góry) – von seiner Entstehung ab 1490 über seinen Niedergang bis zur Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes 2017. Ziel der Ausstellung ist die Vermittlung europäischer Industriekultur im Wandel der Zeit und insbesondere im deutsch-polnischen Kontext.
Die Ausstellung basiert hauptsächlich auf Objekten und Multimedia aus den Sammlungen des Vereins der Heimatfreunde des Tarnowitzer Landes (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) und des Oberschlesischen Landesmuseums sowie auf neuen digitalen Elementen (u. a. Virtual Reality), ergänzt durch ausgewählte Objekte aus den Sammlungen externer Institutionen, wie dem Deutschen Bergbau-Museum (DBM) in Bochum. Eine begleitende Publikation wird Anfang 2025 erscheinen. Die Ausstellung wird auf der großen Sonderausstellungsfläche im Erdgeschoss des Oberschlesischen Landesmuseums auf 450 m² gezeigt und besteht aus einer Einführung und vier Kapiteln sowie einem Multimediabereich.
In der Einführung erfahren die Besucherinnen und Besucher etwas über die geografische Lage von Tarnowitz, die Geschichte der Stadt, die Veränderungen ihrer Grenzen und die ethnisch-sprachliche Zusammensetzung der Bevölkerung im Laufe der Jahrhunderte. Das erste Kapitel behandelt die Geschichte des Bergbaus im Tarnowitzer Land bis zum Jahr 1784, wobei der Schwerpunkt auf der Zeit von 1490 bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges liegt, also auf der Blütezeit des Bergbaus im 16. Jahrhundert und seinem Niedergang im 17. Jahrhundert, als der Dreißigjährige Krieg die Stadt wirtschaftlich ruinierte. Das zweite Kapitel ist der für Tarnowitz wichtigsten Etappe in der Entwicklung des Bergbaus gewidmet, nämlich der Tätigkeit der Königlichen Friedrichsgrube und den mit ihr eng verbundenen Persönlichkeiten – Friedrich Wilhelm von Reden, einem Vorreiter der Industrialisierung in Oberschlesien, und Rudolf von Carnall, der wesentlich zu ihrer Entwicklung beitrug. Der multimediale Bereich konzentriert sich auf die Präsentation audiovisueller Elemente –Archivmaterial, zeitgenössische Filme und Fotografien, 3D-Scans der Tarnowitzer Unterwelt und eine Virtual-Reality-Reise, die die Besucherinnen und Besucher nach Tarnowitz entführt. Im dritten Kapitel steht ein sehr wichtiger und ungewöhnlicher Aspekt der Industriegeschichte von Tarnowitz im Mittelpunkt: der frühe Industrietourismus, der in der Erzählung als Vehikel zur Erinnerung an das industrielle Erbe dient. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Untertagetourismus nach dem Zweiten Weltkrieg, initiiert durch den Verein der Heimatfreunde des Tarnowitzer Landes, sowie mit dem Wiederaufbau und der Eröffnung der beiden heutigen Touristenattraktionen – des Stollens „Schwarze Forelle“ und des Historischen Silberbergwerks.
Neben der Ausstellungseröffnung im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen am Sonntag, 5. Mai um 15 Uhr macht ein Auftaktkonzert der Schlesischen Philharmonie auf die Sonderausstellung aufmerksam. In Kooperation mit der Stiftung Zollverein gastiert am Samstag, 4. Mai um 19 Uhr das Schlesische Kammerorchester der Schlesischen Philharmonie auf dem Essener UNESCO-Welterbe. Sinnbildlich ausgedrückt: UNESCO trifft UNESCO. Der Auftritt markiert zugleich den 20. Jahrestag des EU-Beitritts Polens. Das Schlesische Kammerorchester ist für sein breit gefächertes Repertoire bekannt. Als eines von drei Ensembles der Schlesischen Philharmonie aus Kattowitz (Katowice) erprobt es immer wieder innovative Konzertformate. Beim Konzert auf Zollverein treten Werke von J. S. Bach in einen Dialog mit Kompositionen des Philharmonie-Direktors Adam Wesołowski. Seine „Industriesinfonie“ und sein „Silberkonzert“ verbinden traditionelle musikalische Formen mit industriellen Klängen und Ton- und Filmaufnahmen aus dem Historischen Silberbergwerk in Tarnowitz (Tarnowskie Góry). Die Konzertkarten (30 Euro/20 Euro ermäßigt) sind online unter www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Die von Mariusz Gąsior kuratierte Sonderausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein der Heimatfreunde des Tarnowitzer Landes (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej). Gefördert wird die Ausstellung von der Kulturstiftung der Länder und dem Land Nordrhein-Westfalen. Das „Europakonzert der Schlesischen Philharmonie” wird durch die Landesinitiative Europa-Schecks unterstützt. Europaminister Nathanael Liminski hatte die Landesinitiative vergangenes Jahr ins Leben gerufen, um herausragende Projekte europäischen Engagements durch Vereine, Kommunen, Schulen, Hochschulen, außerschulische Einrichtungen und Institutionen zu ermöglichen und zu würdigen.
Seit 2018 gehört die Druckkunst zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Aus diesem Anlass ruft der Bundesverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) am 15. März 2024 bereits zum sechsten Mal zum Tag der Druckkunst auf. Hierzu finden bundesweit an über 300 Orten Veranstaltungen statt. Neuerdings beteiligt sich auch das Oberschlesische Landesmuseum an diesem Aktionstag und bietet am Freitag, den 15. März von 11 bis 18 Uhr eine Vielzahl von Mitmachaktionen rund um das Thema Druckkunst an. Unter dem Motto „Druck dich satt“ sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Mit dem Tag der Druckkunst lenkt der BBK den Blick auf die vielen Akteure und Einrichtungen, die traditionelle Druckkunsttechniken praktizieren und weiterentwickeln und damit zeigen, wie lebendig dieses Kulturerbe heute noch ist. Gerade die Museen tragen durch das Sammeln und Bewahren wesentlich zum Erhalt dieses kulturellen Erbes bei.
„Zum Tag der Druckkunst geht es im Oberschlesischen Landesmuseum den ganzen Tag einDRUCKsvoll und beeinDRUCKend zu. Wir bieten unseren Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Angebot: Vom einfachen Stempeln für die Kleinsten bis zum wissenschaftlichen Input ist für jeden etwas dabei“, berichtet Anna Appelhoff, die im Oberschlesischen Landesmuseum für Bildung und Vermittlung zuständig ist.
Los geht es um 11 Uhr mit einem offenen Atelier. Die Museumsgäste lernen einfache Drucktechniken kennen, die mit Alltagsgegenständen zu Hause nachgemacht werden können. Es wird eigenes Geschenkpapier bedruckt, Lesezeichen gestaltet und Grußkarten für das bevorstehende Osterfest gebastelt. An mehreren Stationen können verschiedene Drucktechniken ausprobiert und eigene Kunstwerke vervielfältigt werden. Um 13 Uhr stellt Dr. Frank Mäuer in seinem Vortrag ausgewählte Druckgrafiken aus der Sammlung des Oberschlesischen Landesmuseums vor und gibt einen Überblick über die verschiedenen Drucktechniken. Danach wird es praktisch: Um 14:30 Uhr lernen die Besucherinnen und Besucher die Funktionsweise einer Druckerpresse kennen und probieren diese Technik an eigenen Entwürfen aus. Den Abschluss bildet ein praktischer Workshop zum 3D-Druck. Zu Gast ist Omed Abed, der mit den Besucherinnen und Besuchern der Frage nachgeht, wie ein 3D-Druck funktioniert und wo die Möglichkeiten und Grenzen dieser Drucktechnik liegen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Zur besseren Planung des Tages bittet das Oberschlesische Landesmuseum um Anmeldung bis zum 13. März 2024 unter vermittlung@oslm.de.
Ein Vortrag im Oberschlesischen Landesmuseum lädt zur fachlichen Auseinandersetzung mit den Zusatzstunden des Jahres ein.
Alle vier Jahre bekommen wir 24 Stunden geschenkt. So auch 2024: Statt 365 hat dieses Jahr 366 Tage. Warum brauchen wir Schaltjahre und welche Ausnahmen gibt es? Diesen und anderen Fragen geht der Vortrag im Oberschlesischen Landesmuseum am 29. Februar 2024 um 17 Uhr nach. Doch „Schaltjahr. Schalttag. Schaltsekunde. Eine kurze Reise durch die Kalendarien: von Babylon bis Braunschweig“ ist wie der Titel vermuten lässt, aber noch viel mehr. Schnallen Sie sich an für eine spannende Exkursion durch Raum und Zeit.
„Das Schaltjahr ist eine Kuriosität – so viel steht fest. Alle vier Jahre wird der Februar um einen Tag verlängert. Der kürzeste Monat des Jahres wird gestreckt. Doch warum ist das notwendig? Welche astronomischen Phänomene stecken dahinter und gibt es Alternativen zum Schaltjahr?“, wirbt Jan Sundermann für seinen Vortrag, der sich an alle Altersgruppen richtet. Mit seinem Vortrag möchte er Licht ins Dunkel bringen und die Aufmerksamkeit auf diesen besonderen und seltenen Tag lenken.
Dipl.-Ing. Jan Sundermann leitet das Volksbildungszentrum für Himmelskunde (VfW) an der Sternwarte Neanderhöhe SNH. e.V. in Erkrath. Das VfW ist eine anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung und bietet Kurse und Arbeitsgemeinschaften zur Astronomie für Jedermann an (www.snh.nrw).
Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wie eng Architektur und Geschichte miteinander verbunden sind und wie viel Wissen in der Architektur steckt, sollte nicht nur am Tag des offenen Denkmals gezeigt werden. Vor diesem Hintergrund kommen die Macher der Digitalen Bibliothek der Beuthener Architektur nach Hösel.
In einem Vortrag am Donnerstag, 22. Februar 2024 um 18.30 Uhr wird das in der Region einzigartige Bauarchiv vorgestellt, das Dokumente und Informationen zur Baugeschichte von über 4.000 Gebäuden aus dem gesamten Stadtgebiet von Beuthen (heute Bytom) enthält, die im 19. und 20. Jahrhundert entstanden sind. Die Sammlung des Archivs ist eine faszinierende und unschätzbare Wissensquelle über die Entwicklung der Stadt in ihrer Blütezeit. Die Projektverantwortlichen haben sich zum Ziel gesetzt, zumindest einen Teil dieser physisch nahen, aber oft unsichtbaren Zeugnisse des kulturellen Erbes von Beuthen vor dem Vergessen zu bewahren und ihre Entstehungsgeschichte und die damit verbundenen Menschen bekannt zu machen.
„Die räumliche Gestaltung des Stadtzentrums von Beuthen spiegelt die mittelalterliche Anlage wider – mit dem Marktplatz, einem Raster von rechtwinkligen Gassen und Straßen, die oval um die ehemalige Stadtmauer verlaufen. Diese mittelalterliche Form ist jedoch mit Häusern aus dem 19. und 20. Jahrhundert gefüllt. Dies ist das Ergebnis der industriellen Revolution, der Entdeckung von Kohlevorkommen und des Baus von Dutzenden von Industrieanlagen in der ganzen Stadt. Diese Bauten prägen den heutigen Charakter von Beuthen, der sich aus verschiedenen Architekturstilen zusammensetzt: Rundbogenstil, Historismus, Jugendstil, Expressionismus und Funktionalismus“, heißt es im Exposé. „Nicht nur die Formen der Gebäude, sondern auch ihre Details – die Skulpturen und Verzierungen an den Fassaden, die Geländer der Balkone und Treppenhäuser, die meisterhaften Schnitzereien an den Toren, Türen und Fenstern, die Buntglasfenster und sogar die Wandmalereien in den Fluren und Treppenhäusern – machen den einzigartigen Charakter dieser Stadt aus“. Neben dem historischen und kulturellen Wert hat diese Archivsammlung auch einen praktischen Wert, da die einzelnen Akten auch technische Informationen enthalten (z. B. Auslegung von Wasser- und Abwassersystemen), die bei Sanierungen genutzt werden können.
Was verbindet Nordrhein-Westfalen mit dem polnischen Beuthen? Eine Städtepartnerschaft mit Recklinghausen seit dem Jahr 2000.
„Podium Silesia – Beiträge zur Geschichte Oberschlesiens“ nennt sich das Vortragsformat des Oberschlesischen Landesmuseums. Renommierte Oberschlesien-Expertinnen und -Experten stellen einem breiten, interessierten Publikum regelmäßig wichtige historische Themen in Wort und Bild vor, greifen aktuelle Forschungsdebatten auf und laden zur Diskussion ein. Die Veranstaltungen finden mehrmals im Jahr im Haus Oberschlesien in Ratingen und bei weiteren Partnerinstitutionen statt.
Der Eintritt ist stets frei. Die Veranstaltungen sind öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mit einem 3-in-1-Konzept lädt das Oberschlesische Landesmuseum am Internationalen Frauentag (08.03.) zu einem Rundgang durch die Dauerausstellung, einem anschließenden Referat und einem Recital ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt Tomasz Zawierucha (Folkwang Universität der Künste) mit einem eigens für diesen Anlass zusammengestellten Repertoire. Der Eintritt ist frei.
Der Nachmittag startet um 17 Uhr mit einer Kurzführung durch das Museum mit dem Museumsdirektor. Dabei wird die Dauerausstellung erkundet. Ab 18 Uhr zeigt der gebürtige Oberschlesier Leonhard Wons anhand von Erinnerungsstücken, Foto- und Filmmaterial aus der alten und neuen Heimat sowie aus seinem Familienarchiv, wie vielfältig die oberschlesischen Jahres- und Lebensbräuche einst waren und was davon heute noch Bestand hat. Unter den Stichworten „Kroschonki, Klappern und Kreuzelstecken“ wird so auch auf Ostern und den Frühling eingestimmt. Musikalischer Höhepunkt ist ein Gitarrenkonzert im Haus Oberschlesien mit Prof. Tomasz Zawierucha (Folkwang Universität der Künste). Eine internationale Reise in nahe und ferne Winkel der Welt erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Mittelpunkt stehen Stücke der Japanerin Mayako Kubo und Miniaturen der polnischen Gitarristin, Komponistin und Pädagogin Tatiana Stachak. Romantisch und stimmungsvoll wird es mit Musik des Italieners Mauro Giuliani und klassisch mit Bach und Chopin. Eine meisterhafte Mischung!
Der international anerkannte Gitarrist Tomasz Zawierucha machte bereits während seines Studiums bei Thomas Müller-Pering und Monika Rost durch erste Preise bei renommierten internationalen Gitarrenwettbewerben wie Ville d‘Antony – Paris, Dundee oder dem Tokyo International Guitar Contest auf sich aufmerksam. Über seinen Soloabend in der Bunka-Kaikan Recital Hall in Tokio schrieb Jun Sugawara vom Gendai Guitar Magazine: „Herr Zawierucha ist zweifellos eine der interessantesten Persönlichkeiten der Gitarrenszene seiner Generation“. Der Gitarrist ist regelmäßiger Gast bei renommierten Festivals wie Stuttgart International Classic Guitar Festival, Liechtensteiner Gitarrentage, Internationales Gitarren-Symposium Iserlohn und Rencontres de la Guitare Paris. Als gefragter und engagierter Kammermusiker arbeitet er mit Künstlern wie dem Grammy-Preisträger John Dearman, Ricardo Gallén und Olaf Van Gonnissen zusammen. Zawierucha leitete Gitarrenklassen an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch. Darüber hinaus ist er Gastkünstler am Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Seit 2014 ist er Professor für Gitarre an der Folkwang Universität der Künste in Essen.
Die Veranstaltung wird von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ratingen, Nadine Mauch, unterstützt, die sich in einem Grußwort an die Gäste der Veranstaltung wendet: „Wie zerbrechlich unsere Demokratie geworden ist, erleben wir nicht erst seit dem 24. Februar 2022 mit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Demokratie ist in Gefahr: Im Krieg gegen die Ukraine, auf den Straßen von Belarus, Iran und Afghanistan. Weltweit wird die Demokratie als Staats- und Regierungsform auf schamlose und gewissenlose Weise verbal herabgewürdigt und deren Repräsentantinnen sogar physisch attackiert. Überall zeigt sich, dass Frauenrechte nicht unantastbar sind. Wie verankert und gesichert Frauenrechte sind, ist ein Gradmesser für den freiheitlich-demokratischen Zustand einer Gesellschaft. Es geht hier nicht um ‚Frauenfragen‘, sondern um Menschenrechte. Sie zu schützen und zu verteidigen ist unsere Aufgabe. Unsere Solidarität gilt heute allen Frauen, die für Menschenrechte, Frauenrechte und ein Leben in Frieden und Sicherheit kämpfen.“
Im Rahmen des Neujahrsempfangs am 21. Januar wurde das Jahresprogramm des Oberschlesischen Landesmuseums vorgestellt. Was ist geplant und auf welche Highlights können sich die Besucher freuen?
Mit einem Workshop am Samstag, 10. Februar (13-15 Uhr) unter dem Titel „Daten und Dokumente. Was lese ich aus den Exponaten?“ und einem Finissage-Rundgang mit dem Museumsdirektor am 18. Februar um 15 Uhr endet die Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“. Die Ausstellung beleuchtete die Geschichte Oberschlesiens in den Jahren 1922-1939, als die Region zwischen Deutschland und Polen geteilt war und die Bevölkerung vor ökonomischen und gesellschaftlichen Herausforderungen stand.
Am 5. Mai eröffnet die Sonderausstellung „Silberfieber. Der Tarnowitzer Bergbau – das UNESCO-Welterbe in Oberschlesien“, die gemeinsam mit dem Verein der Heimatfreunde des Tarnowitzer Landes – dem Trägerverein der einzigen UNESCO-Welterbestätte Oberschlesiens – konzipiert und erarbeitet wird. Die Sonderausstellung zeigt die Geschichte des Bergbaus in Tarnowitz/Tarnowskie Góry – von seiner Entstehung ab 1490 über den Niedergang bis zur Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes 2017. Ziel der Ausstellung ist die Vermittlung europäischer Industriekultur im Wandel der Zeit und insbesondere im deutsch-polnischen Kontext. Zum Auftakt der Sonderausstellung gastiert die Schlesische Philharmonie auf Zeche Zollverein. Das Konzert am 4. Mai versteht sich als musikalisches Vorprogramm und markiert zugleich den 20. Jahrestag des EU-Beitritts Polens. Ermöglicht wird die Umsetzung des Ausstellungsvorhabens neben der institutionellen Förderung des Ministeriums für Kultur und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen auch durch die Kulturstiftung der Länder und die Landesinitiative Europa-Schecks des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen.
Auf der Ausstellungsfläche im 1. Obergeschoss ist noch bis Ende Juni die Sonderausstellung „Dem Regiment zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Preußische Regimenter in der Provinz Schlesien 1871-1914: Zwischen Militarismus und Alltagsleben“ zu sehen. Die Schau setzt sich historisch-kritisch mit der Wechselwirkung zwischen militärischer und ziviler Sphäre in Preußen auseinander und präsentiert über 700 Objekte aus der Sammlung von Norbert Kozioł aus dem oberschlesischen Peiskretscham/Pyskowice, der in mehr als vier Jahrzehnten Dutzende von Originaluniformen und Erinnerungsstücken der in Schlesien stationierten Einheiten des preußischen Militärs zusammengetragen hat. Ab März wird auch ein begleitender Katalog zur Ausstellung erhältlich sein, der nicht nur für Sammler interessant sein wird. Ab Herbst wird dort die Ausstellung „Schlesisches Theater. Geschichte und Gestalten“ zu sehen sein, die in Partnerschaft mit dem Schlesischen Theater in Kattowitz/Katowice, einer der bedeutendsten Theaterbühnen Polens, verwirklicht wird. Die Sonderausstellung zur Geschichte und aktuellen Arbeit des Theaters, das 1907 als Stadttheater eröffnet wurde, spiegelt die wechselvolle Geschichte der Region und die politischen Veränderungen wider. Neben dem historischen Kontext stellt die Ausstellung mit dem Theater verbundene Personen, Kostüme ausgewählter Aufführungen und Fragmente von Theaterstücken vor. Ergänzt wird die Ausstellung durch Videomaterial und großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien. Auf diese Weise hat die Ausstellung sowohl einen historisch-dokumentarischen als auch einen persönlichen Wert – sie erzählt die Geschichte der Menschen, die das Theater ausmachen. Auch diese Ausstellungseröffnung ist auf zwei Tage verteilt, da vor der Eröffnung in Ratingen eine Aufführung des Stückes „Byk“ (Stier) im Katakomben-Theater in Essen geplant ist.
In einer weiteren Sonderausstellung widmet sich das Museum ab dem 20. Juli anlässlich des 80. Jahrestages des Hitler-Attentats drei Persönlichkeiten mit oberschlesischen Bezügen, die Teil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus waren, nämlich Michael Graf Matuschka, Paulus von Husen und Hans Lukaschek. Ihre Rolle im Widerstand und ihr Schicksal werden in den Kontext der Ereignisse und Folgen rund um das Attentat im Führerhauptquartier Wolfsschanze eingebettet.
Darüber hinaus werden weitere Highlights geboten: Am 8. März, dem Weltfrauentag, erwartet Sie ein Programm mit einer Führung mit Dr. David Skrabania, einem österlichen Vortrag von Leonhard Wons und einem Gitarrenkonzert mit Tomasz Zawierucha (Folkwang Universität der Künste), der ein eigens für diesen Anlass zusammengestelltes Repertoire zum Besten gibt. Das Programm wird von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ratingen mitfinanziert. Am 18. April stellt der Historiker und Autor Andreas Kossert seinen Bestseller „Flucht – Eine Menschheitsgeschichte“ vor. Wie kaum ein anderer versteht es Kossert, die Flüchtlingsbewegungen des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen historischen Zusammenhang zu stellen. Immer nah an Einzelschicksalen und auf bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen – und warum es für Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Auch diese Veranstaltung ist das Ergebnis einer Partnerschaft, nämlich mit dem Haus Schlesien in Königswinter, wo Kossert sein Buch am 19. April vorstellen wird. Am 19. Mai startet das Oberschlesische Landesmuseum unter dem Schlagwort „Handverlesen“ mit einer Entdeckerführung in den Internationalen Museumstag. Es folgt eine kreative Schreibwerkstatt mit Mariusz Hoffmann. Anschließend wird sein Debütroman „Polnischer Abgang“ (erschienen im Piper Verlag) in einer moderierten Autorenlesung vorgestellt und mit dem Publikum diskutiert. Am 15. Juni findet das alljährliche Sommerfest mit Live-Musik und vielen Attraktionen für Jung und Alt auf der Bühne und rund um das Oberschlesische Landesmuseum statt. Im Bereich der Bildung und Vermittlung wird auch 2024 die bewährte Reihe „Samstags im Museum“ fortgesetzt. Zu Anlässen wie Muttertag, Erntedank, Bundesweiter Vorlesetag oder Weltkindertag werden kreative Workshops angeboten.
Stets aktuelle Informationen finden Sie unter www.oslm.de. Dort können Sie auch den kostenlosen Newsletter abonnieren, der eine weitere Möglichkeit bietet, gut informiert zu bleiben.
Im Rahmen des Neujahrsempfangs des Oberschlesischen Landesmuseums am vergangenen Sonntag (21.01.2024) wurde nicht nur das Jahresprogramm des Museums vorgestellt und das Werk von Anna Tatarczyk präsentiert, sondern auch der seit einigen Tagen auf dem YouTube-Kanal des Museums veröffentlichte Imagefilm öffentlich uraufgeführt.
Die Filme (mit Roman Poryadin als Gebärdensprachdolmetscher) stellen das Spektrum der Museumsarbeit anschaulich dar und geben Einblicke in Schwerpunkte und Akzentuierungen. Unter https://www.youtube.com/user/oslmRatingen sind beide Videos abrufbar.
Das Museum hat im Jahr 2023 zwei Anträge auf Fördermittel aus dem Inklusionsscheck NRW gestellt und zwei Bewilligungen erhalten. Beim zweiten Projekt hat Olivia Pustowka im Rahmen ihres studentischen Praktikums mit Unterstützung des Museumsteams und der Eifeler Presse Agentur einen gedruckten Kurzführer in Leichter Sprache entwickelt und auf dieser Grundlage die Website entsprechend überarbeitet.
In der Pressemitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird der Inklusionsscheck NRW als Erfolgsgeschichte bezeichnet. „Der Inklusionsscheck NRW zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen wird so stark nachgefragt wie nie zuvor: Im Jahr 2023 haben 259 Vereine und Organisationen die Pauschale in Höhe von jeweils 2.000 Euro unbürokratisch erhalten, um ihre Angebote inklusiv zu gestalten. Nach jeweils rund 200 Bewilligungen in den beiden Vorjahren wurde damit ein neuer Rekord aufgestellt“, heißt es auf der Website des nordrhein-westfälischen MAGS.
Das seit 1983 in Ratingen ansässige Museum widmet sich der Kultur und Geschichte Oberschlesiens im historischen und zeitgenössischen Kontext. Es sammelt und bewahrt das kulturelle Erbe einer Region im Herzen Europas, die im Laufe der Jahrhunderte durch vielfältige kulturelle, sprachliche und politische Einflüsse geprägt wurde. Als ehemaliges deutsches Siedlungsgebiet liegt Oberschlesien heute auf dem Gebiet Polens und Tschechiens. Diese Geschichte in all ihren Facetten zu vermitteln, ist die Aufgabe des Oberschlesischen Landesmuseums. Zudem versteht sich das Oberschlesische Landesmuseum als Partner im gesamteuropäischen Dialog und im Geiste der Völkerverständigung. Es wendet sich an alle, die sich für die vielfältigen kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Ost und West interessieren. Dabei werden Menschen mit und ohne persönlichen Bezug zu Oberschlesien gleichermaßen angesprochen. Denn in den Ausstellungen und Veranstaltungen greift es (kultur-)historische Themen auf, die neben dem Bezug zu Oberschlesien auch eine hohe allgemeine Relevanz haben.
Gleich zwei Anlässe – Neujahrsempfang und Eröffnung der Ausstellung „Form – Farbe – Licht“ der aus dem oberschlesischen Loslau (Wodzisław Śląski) stammenden Künstlerin Anna Tatarczyk – locken am Sonntag, 21. Januar 2024, um 15 Uhr ins Haus Oberschlesien (Bahnhofstraße 71, Ratingen-Hösel). Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von Olga Glibovych und Yaromyr Bozhenko. Auf dem Programm stehen Werke von Frédéric Chopin, Viktor Kosenko und Myroslav Skoryk. Für einen stimmungsvollen Auftakt sorgen zudem die ukrainischen Sternsinger.
Der Neujahrsempfang ist eine kleine Tradition des Oberschlesischen Landesmuseums und verbindet die Vorstellung des Jahresprogramms mit Kunst und Musik. Erstmals wird öffentlich, an welchen Projekten das Team um Museumsdirektor Dr. David Skrabania fleißig arbeitet. „Wir freuen uns sehr, die Schwerpunkte unserer Arbeit für 2024 vorzustellen und auf ein neues Jahr voller Kulturvermittlung rund um unsere Bezugsregion und gesellschaftlich relevante Themen einzustimmen“ – so Skrabania. Sonderausstellungen zum Thema Industriekultur, Theater, Präsentationen zu historischen Anlässen, kreative Workshops, das jährliche Sommerfest, Vorträge und Lesungen, Kooperationen und digitale Experimente erwarten 2024 Gäste aus nah und fern. „Wer Details erfahren möchte, ist am Sonntag, 21. Januar, herzlich willkommen.“
Die öffentliche Veranstaltung findet bei freiem Eintritt statt. Im Vorfeld des Empfangs findet ab 13 Uhr eine Doppelführung durch die aktuellen Sonderausstellungen „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ und „Dem Regiment zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Preußische Regimenter in der Provinz Schlesien 1871-1914: Zwischen Militarismus und Alltagsleben. Eine Ausstellung aus der Sammlung Norbert Kozioł“ mit Marius Hirschfeld statt. Das Museum kann ganztägig (11-18 Uhr) bei freiem Eintritt erkundet werden.
Die an diesem Tag offiziell beginnende Ausstellung „Form – Farbe – Licht“ von Anna Tatarczyk zeigt Leinwände, die in den vergangenen vier Jahren entstanden sind. Vor dreißig Jahren kam Tatarczyk ins Rheinland und widmete sich zunächst der gegenständlichen, später der abstrakten Malerei. Seit sieben Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Wirkung von Farben und Formen. Vor allem die symbolträchtige Raute überträgt sie in Acryl auf Leinwand. Sie lässt sie auf der Spitze tanzen und fängt mit ihr das Licht ein. Es ist ein Wechselspiel zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, zwischen Stillstand und Bewegung. Tatarczyk schätzt diese Form nicht nur wegen ihrer Ästhetik: Ihr Werk steht für die Fortführung der Konkreten Kunst. Anna Tatarczyk studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. A. R. Penck und Prof. Siegfried Anzinger und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf und Wuppertal.
Zum Jahresende lockt das Oberschlesische Landesmuseum mit zahlreichen Angeboten. Zu den Höhepunkten zählen sicherlich der Gastvortrag von Dr. Lutz Schrader am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr und die Projektvorstellung von Izabella Kühnel über Leben und Werk Franz Landsbergers am Freitag, 15. Dezember, um 17 Uhr. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.
Unter dem Titel „Zunahme ethnopolitischer Konflikte: Déjà-vu oder neues Phänomen?“ wirft Dr. Lutz Schrader am 10. Dezember um 15 Uhr zunächst einen Blick zurück in die Jahre vor und nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und ordnet die damalige Situation vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der bipolaren Weltordnung und der Entstehung zahlreicher neuer (National-)Staaten ein. In einem zweiten Schritt richtet sich das Augenmerk auf das Wiederaufflammen ethnopolitischer Konflikte in den letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnten. Auf der Suche nach den Ursachen werden verschiedene Hypothesen diskutiert, darunter der Aufstieg populistischer und autokratischer Staaten und Bewegungen. Schließlich wird in einem dritten Schritt überlegt, wie eine erneute Einhegung und Befriedung ethnonationaler Konflikte gelingen könnte.
Im Mittelpunkt der Projektvorstellung am 15. Dezember um 17 Uhr stehen die Geschichte der Stadt Beuthen (Bytom) und ihrer Bewohner zur Zeit der industriellen Revolution, die Visionäre, die in Beuthen das erste städtische Theater- und Konzerthaus Oberschlesiens entstehen ließen, und vor allem dessen Gründer Franz Landsberger. Diesem bedeutenden Beuthener wurde 1925 zum Dank für seine Verdienste eine Gedenktafel im Foyer des Theaters gewidmet, die in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten entfernt wurde. Der Vortrag schildert auch die Geschichte der Nachkommen von Franz Landsberger, die 2016 und 2022 Beuthen besuchten und dabei halfen, die Erinnerung an ihre Familie wiederherzustellen. „Das geplante Buch zeigt die historischen Verflechtungen einer Region, die häufig die Nationalität wechselte. Es erzählt von der lokalen Geschichte, von der Vielfalt der Kulturen, von Toleranz und Akzeptanz, aber auch vom Drama des Holocaust, das sich hier abgespielt hat. Es zeigt die Probleme der Grenzregion vor dem Hintergrund der persönlichen Erfahrungen der Familie“, führt die Referentin Izabella Kühnel ein.
Verpassen Sie auch nicht die letzten öffentlichen Führungen am 10. Dezember um 13 Uhr und am 17. Dezember um 15 Uhr. Wer die beiden Escape Rooms des Museums hintereinander spielen möchte, sollte sich für den Escape Room Double am 16. Dezember unter vermittlung@oslm.de anmelden. Wer unter 16 Jahre alt ist und ohne Erwachsene rätseln möchte, ist beim Rätselspaß am Mittwoch, 20. Dezember, gut aufgehoben (auch hier ist eine Anmeldung erforderlich).
Eine literarische Sprach- und Gattungsreise verspricht das Team des Oberschlesischen Landesmuseums am Freitag, 17. November, von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auch kurzentschlossene Vorlesepaten sind herzlich willkommen.
Im Mittelpunkt des Bundesweiten Vorlesetages stehen bekannte und unbekannte Texte deutscher, polnischer, tschechischer und englischer Autoren. Den Anfang macht Sherlock Holmes mit „The Hound of the Baskervilles“ von Sir Arthur Conan Doyle. Dem wohl berühmtesten Detektiv folgt um 13 Uhr der polnische Spottstrolch, der „nicht isst, nicht trinkt und nur vom Lachen lebt“, im Original also „Cudaczek-Wyśmiewaczek“ von Julia Duszyńska. Um 14 Uhr geht es weiter mit „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch. Ob dieser Name die Schülerinnen und Schüler der Höseler Grundschule ins Museum locken kann? Das Museumsteam ist darauf bestens vorbereitet. Lyrisch und weihnachtlich wird es um 15 Uhr mit Gedichten von Artur Oppman. Auch tschechische Märchen dürfen nicht fehlen und so begrüßen wir ab 16 Uhr Liba Steeger mit einer Auswahl ihrer Favoriten dieses Genres. Ab 17 Uhr wird die im Museum erhältliche zweisprachige Publikation „Jesderkusch! Oder die verzwickte Geschichte Oberschlesiens“ in deutscher und polnischer Sprache vorgestellt. Den Ausklang bildet eine Märchenstunde mit Anna Appelhoff und Katarzyna Lorenc, die durch den gesamten Veranstaltungstag leiten.
Eine Lesereise durch Nordrhein-Westfalen führt die polnische Autorin Dominika Buczak nach Ratingen, Bielefeld und Bonn. Zwischen dem 23. und 25. November finden insgesamt drei Lesungen der in Warschau lebenden Schriftstellerin statt.
Im Mittelpunkt der deutsch-polnischen Literaturbegegnungen steht das neueste Buch „Całe piękno świata“, das 2022 in polnischer Sprache erschienen ist. Ein vorliegender Auszug aus der deutschen Übersetzung (von Alexandra Tobor) macht es möglich, das in Polen gefeierte Buch dem deutschsprachigen Publikum näherzubringen. „Alle Schönheit dieser Welt“ (so die deutsche Übersetzung des Titels) ist eine bewegende Geschichte über das Nachkriegsschicksal zweier Familien, einer polnischen und einer deutschen, die unter einem Dach leben (müssen). Buczak verarbeitet in ihrem Roman eine Geschichte, die von den Erfahrungen ihrer eigenen Familie inspiriert ist. Erzählt wird – wie in allen Büchern der polnischen Autorin – immer aus der Perspektive der Frauen.
Buczak gelingt etwas Einzigartiges: Sie personalisiert die Ereignisse der Nachkriegszeit, die Umsiedlung und Vertreibung, die Ankömmlinge und die Abreisenden bekommen Namen und Gesichter: Stach und Dorka, Peter und Eva, Renate und Paweł. Erzählt wird von Kriegs- und Nachkriegszeit in Lichtenwalde (heute Poręba) bei Glatz (Kłodzko) in Niederschlesien, von Gewalt und Tod, von schmerzhaften Erinnerungen und neuer Wirklichkeit. Schwarz-Weiß ist die Erzählung aber keineswegs. Nicht nur, weil die Einteilung in Gut und Böse für vom Krieg betroffene Zivilisten selten einfach ist, sondern auch, weil mit dem im Buch aufkeimenden Frühling eine schimmernde Annäherung zwischen den beiden unter einem Dach lebenden Familien einsetzt. Ein Haus, zwei Familien. Emotional, aber nicht emotionalisierend geht es hinein in die Erlebnisse zwischen September 1946 und Mai 1947. Was auf den 352 Seiten der polnischen Fassung gilt, ist das Prinzip Hoffnung. Nur hofft hier jeder auf etwas anderes.
Milena Butt-Pośnik, die die Lesung mit dem Verein DialogFelder in Bonn organisiert, schätzt das Buch vor allem wegen seiner Aktualität in unserer komplizierten Zeit. Sie hat es gleich mehrfach gekauft und im Freundeskreis herumgereicht. „Die Rezensionen unserer Leserinnen waren sehr bewegend, denn unter uns sind viele Frauen, deren polnische und deutsche Vorfahren auf beiden Seiten solcher Geschichten standen und deren transgenerationale Traumata endlich benannt, gesehen und ans Licht gelassen wurden.“ Der deutschen Leserschaft bleibt zu wünschen, dass diese Geschichte bald auch in deutscher Sprache vorliegt. Darüber sind sich auch die weiteren Organisatorinnen – Katarzyna Lorenc für das Oberschlesische Landesmuseum und Agnieszka Wróbel-Grabbe für den Verein Polnischer Frauen in OWL – einig.
Bei allen drei deutsch-polnischen Lesungen – 23. November, 18.30 Uhr im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen; 24. November, 18.00 Uhr in der Stadtbibliothek Bielefeld; 25. November, 17 Uhr im Bistro Zwischen den Polen in Bonn – ist der Eintritt frei. Wer „Całe piękno świata” schon vor der Lesung kennenlernen und sicher sein möchte, dass die Autorin das Exemplar signiert, kann das Buch über die Online-Buchhandlung Polbuch beziehen. Die Lesereise erfolgt mit Unterstützung von Fundacja Wolność i Demokracja (Stiftung für Freiheit und Demokratie) aus Warschau.
Im vorletzten öffentlichen Gastvortrag des Rahmenprogramms zur Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ im Oberschlesischen Landesmuseum spricht Prof. Dr. em. Roland Sturm am Donnerstag, 19. Oktober, um 18.30 Uhr zum Thema „Nordirland und Schottland: Identitäten im (unlösbaren?) Konflikt“. Der Eintritt ist frei.
„Die Gesellschaften in Nordirland und Schottland sind gespalten. Unionisten (pro-britische Identität) stehen Nationalisten (auf Unabhängigkeit bedachte Identität) gegenüber. Hier wie dort sollte es eine regionale Selbstverwaltung geben, die diese Spaltung überwindet. Trotz oberflächlicher Gemeinsamkeiten sind beide Loyalitätskonflikte grundverschieden“, heißt es in der einleitenden Feststellung. Der Vortrag untersucht die historischen und aktuellen Ursachen der Dauerkonflikte, zeigt ihre Entwicklung auf und diskutiert ihren aktuellen Stand mit Blick auf zukünftige „Lösungen“.
Prof. Dr. em. Roland Sturm ist seit 1996 ordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Von 2000 bis 2008 war er Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Gastprofessor an der University of Washington, Seattle (1992), Gastprofessor an der Peking University (2007) und Gastprofessor an der Universität Pompeu Fabra (2014). 15 Jahre lang war er Mitglied des Vorstands der Sektion Vergleichende Politikwissenschaft der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und ist seit 2009 Vertrauensdozent der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. Er ist Verfasser von zahlreichen Publikationen wie unter anderem der Monographie „Das Schottland-Referendum. Hintergrundinformationen und Einordnung“ (2015) und des profunden Länderberichts Großbritannien für die Bundeszentrale für politische Bildung (2019), der vertiefte Einblicke in Geschichte, Politik, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft eines Landes auf Identitätssuche vermittelt.
Die durch die Vortragsreihe thematisch ergänzte Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ greift noch bis zum 18. Februar 2024 die komplexe Thematik der Teilung Oberschlesiens im Jahr 1922 auf und knüpft zugleich an zeitgeschichtliche Ereignisse und aktuelle gesellschaftspolitische Prozesse in Europa an. Details und weitere Informationen sind auf der Website www.oslm.de zu finden.
Anfang August übernahm Anna Appelhoff den Bereich Bildung und Vermittlung im Oberschlesischen Landesmuseum. Und Ihre Ideen sind bereits spürbar.
Anlässlich des Weltkindertages lädt das Museum am Mittwoch, den 20. September, zu einem ganztägigen Spieletag ein. An verschiedenen Stationen im Museum werden mehr oder weniger bekannte Spiele zum Mitmachen und Ausprobieren angeboten. „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie wichtig das Spielen für die Entwicklung eines Kindes ist. Dabei geht es nicht nur darum, dass das Kind Spaß hat – Spielen hilft, wichtige Kompetenzen für das Leben zu erwerben und fördert schon früh die Sprachentwicklung. Der Austausch mit den Spielkameraden und das Benennen von Regeln, Spielgegenständen und damit verbundenen Spielinhalten erweitert den Wortschatz und schult den Sprachgebrauch. Außerdem lernen die Kinder den Umgang mit ihren Mitmenschen“, erklärt Appelhoff.
Der September klingt mit der beliebten neanderland Museumsnacht am 29. September (18-23 Uhr) aus. Die oberschlesische Entdeckungsreise in fünf Akten macht die Bezugsregion mit allen Sinnen erlebbar. Unter den Headlines: Wo liegt Oberschlesien? Wer kommt aus Oberschlesien? Wie schmeckt Oberschlesien? (Zweiteiler) und Wie klingt Oberschlesien? (mit einem Foyerkonzert von Frela Blue) wird die Kultur Oberschlesiens unterhaltsam vorgestellt. Nach dem Erfolg der Reihe Rätselspaß am Mittwoch in den Sommerferien können sich die jungen Gäste (9-16 Jahre) nun auch in den Herbstferien in Begleitung und unter Anleitung von Annika Henneberger in den beiden Escape Rooms des Museums austoben. Am 4. und 11. Oktober geht es jeweils um 13, 15 und 17 Uhr los. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter vermittlung@oslm.de möglich. Gestickt gegen den Herbstblues lädt das Landesmuseum am 4. November zu einem Stickworkshop am Beispiel der Schönwälder Stickerei unter der künstlerischen Leitung von Agnieszka Kalnik ein. Am 8. November findet die erste Taschenlampenführung statt und am 17. November, dem Bundesweiten Vorlesetag, wird den ganzen Tag gemeinsam vorgelesen. Literarische Beiträge in deutscher, polnischer und tschechischer Sprache wurden bereits ausgewählt. Weitere Vorlesepaten in verschiedenen Sprachen sind herzlich eingeladen, sich zu melden. Das Jahr endet mit einer Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Am 2. Dezember machen sich die Besucherinnen und Besucher mit schlesischen Weihnachtstraditionen und dem Basteln von einzigartigem Tannenbaumschmuck vertraut. Passend dazu wird am 6. Dezember bei der zweiten Taschenlampenführung der Schatz des Heiligen Nikolaus gesucht. Am 20. und 27. Dezember ist wieder Rätselzeit. Dann verbirgt sich in der Zeitkapsel, die im Escape Room versiegelt wird, vermutlich eine essbare Kostbarkeit.
Anna Appelhoff hat viel vor und freut sich über die Vermittlungsmöglichkeiten des Museums. Ziel ist es, das Angebot zu diversifizieren und das Museum als einen dritten Ort der Begegnung und des Lernens zu etablieren. Appelhoff wurde 1991 in Mülheim an der Ruhr geboren und verbrachte einige Jahre ihrer Kindheit in Flatow (Złotów) in der Woiwodschaft Großpolen. 2017 schloss sie ihr B.A.-Studium in Anglistik und Amerikanistik sowie Kunstgeschichte ab und widmete sich im M.A.-Studium ganz der Kunstgeschichte. Als freiberufliche Kunstvermittlerin arbeitete sie mit unterschiedlichen Zielgruppen und Vermittlungskonzepten. Nach erfolgreichem Abschluss des M.A.-Studiums war sie im Bereich der Kunstvermittlung am Lehmbruck Museum in Duisburg tätig, wo sie auch erste Erfahrungen in der Realisierung von Ausstellungen sammeln konnte.
Das Konzertduo Klaus-Peter Riemer (Flöte) und Miyuki Brummer (Klavier) widmet sich am Samstag, 14. Oktober, um 18 Uhr, in einem eigens für die Reihe Salon Silesia konzipierten Programm Werken von Carl Ditters von Dittersdorf, Edmund Nick, Johann Christoph Altnikol, Carl Maria von Weber und Franz Schubert. Mit der Konzertreihe, die 2022 ins Leben gerufen wurde, soll ein Beitrag zur Verbreitung der klassischen Musik schlesischer Komponisten und Musiker geleistet werden.
Klaus-Peter Riemer ist ein national und international tätiger Konzertflötist, der bereits mit 27 Jahren einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Wuppertal erhielt. Diese Tätigkeit übte er 17 Jahre lang aus. Orchestererfahrung sammelte er u. a. bei den Düsseldorfer Symphonikern, dem Gürzenich Orchester Köln und dem Bach-Verein Orchester Bonn. Riemer konzertierte als Solist in vielen Städten Europas sowie bei zahlreichen internationalen und nationalen Festivals u. a. dem 1. Europa-Bach-Festival 2005 Paris, dem Flandern-Festival Tongeren/Belgien, den Bad Hersfelder Festspielen.
Die in Japan geborene Konzertpianistin Miyuki Brummer erhielt ihren ersten Musikunterricht im Alter von vier Jahren und ihren ersten Klavierunterricht im Alter von acht Jahren. Bereits vier Jahre später hatte sie ihren ersten Orchesterauftritt als Solistin. Brummer schloss ihr Magisterstudium an der Universität Mozarteum Salzburg mit Auszeichnung ab. Sie ist mehrfache Preisträgerin bei Klavierwettbewerben und war Finalistin beim „Internationalen Klavierwettbewerb A.M.A. Calabria“. Konzertreisen führten sie u.a. nach Japan, Österreich, Spanien, Frankreich und Belgien. Ihr deutschlandweites Engagement erstreckt sich von Düsseldorf über Berlin, Dresden bis nach Leipzig.
Die Konzertkarten kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Sie können direkt über den Link (https://tickets.neanderticket.de/tickets/nr=481143) erworben oder telefonisch unter 02102-965202 und per E-Mail an kasse@oslm.de reserviert werden. Die Veranstaltung findet im Haus Oberschlesien statt.
Im mittlerweile vierten Vortrag des Begleitprogramms zur Sonderausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums widmet sich Prof. Dr. Peter A. Kraus von der Universität Augsburg am Donnerstag, 14. September um 18.30 Uhr den Regionen Katalonien und Baskenland.
„Nach einer langen Periode der politischen Gewalt hat sich die Lage im Baskenland mittlerweile nachhaltig entspannt. Demgegenüber rückte im vergangen Jahrzehnt Katalonien im Zuge der Zuspitzung des Konflikts mit dem Zentralstaat ins Rampenlicht der internationalen Berichterstattung. Zwischen den beiden sogenannten ‚historischen Nationalitäten‘ gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber auch erhebliche Unterschiede“, heißt es im Exposé. Der Vortrag ordnet beide Fälle zunächst grob in den Gesamtkontext der europäischen Minderheitenpolitik ein. Anschließend werden die wichtigsten Merkmale der politischen Entwicklung in beiden Regionen seit dem Ende der Franco-Diktatur und der Wiedererlangung der Autonomie dargestellt. In einem dritten Schritt werden die relevanten aktuellen Konfliktparameter der spanisch-katalanischen und spanisch-baskischen Beziehungen sowie die Rolle Europas in der Konfliktbearbeitung diskutiert. Die Teilnahme an der Vortragsreihe ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Dr. Peter A. Kraus, geboren 1960 in Barcelona, ist ordentlicher Professor für Politikwissenschaft, Leiter des Instituts für Kanada-Studien und Co-Direktor des Jakob-Fugger-Zentrums/Center for Advanced Transnational Studies an der Universität Augsburg sowie regelmäßiger Gastprofessor am Lehrstuhl für Politikwissenschaft der Universität Pompeu Fabra, Barcelona. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Ethnische Beziehungen, Staatsbürgerschaft und Einwanderung, vergleichende politische Soziologie und Analyse der politischen Kultur, moderne Demokratien und Demokratietheorie, europäische Politik und europäische Integration. Er promovierte zum Thema „Multinationale Gesellschaft, Staat und Demokratie. Das Modell der Autonomen Gemeinschaften in Spanien“. Kraus ist Mitglied verschiedener Gremien, darunter beratender Sachverständiger des Deutschen Bundestages und Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er veröffentlichte unter anderem „Eine kleine Geschichte Kataloniens“ im Suhrkamp Verlag.
Die Vortragsreihe begleitet seit Anfang des Jahres die Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“. Im Vorfeld des Vortrags am 14. September findet um 17 Uhr eine Führung durch die Ausstellung mit dem Leiter des Museums, Dr. David Skrabania, statt. Nach dem Septembertermin spricht am 19. Oktober Prof. em. Roland Sturm über Nordirland und Schottland und am 10. Dezember Dr. Lutz Schrader in einem abschließenden Vortrag über die aktuelle Zunahme ethnopolitischer Konflikte. Details und weitere Informationen sind auf der Website www.oslm.de zu finden.
Zu überregionalen Anlässen lädt das Oberschlesische Landesmuseum zu zwei Sonderführungen ein. Anlässlich des Europäischen Tages der jüdischen Kultur am Sonntag, 3. September, führt Dr. Frank Mäuer um 15 Uhr durch die Sonderausstellung „Jüdische Spuren. Von der Synagoge zum Gebetshaus in Beuthen“. Der Kostenbeitrag beträgt 5 Euro. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, ebenfalls um 15 Uhr, präsentiert Dr. David Skrabania die Architektur Oberschlesiens um 1922. Der Eintritt ist frei.
Die Sonderschau „Jüdische Spuren. Von der Synagoge zum Gebetshaus in Beuthen“ ist ein Kooperationsprojekt mit dem Oberschlesischen Museum in Beuthen (Bytom). Die Kabinettausstellung zeigt ausgewählte Objekte aus der eigenen Sammlung sowie – als Leihgaben aus Beuthen – Objekte aus dem aufgelösten Bethaus der jüdischen Gemeinde in Beuthen. Sie erinnert unter anderem an das blühende jüdische Gemeindeleben inmitten der Beuthener Stadtgesellschaft im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur, der seit 1999 jedes Jahr am ersten Sonntag im September begangen wird. Er wird mittlerweile in fast 30 europäischen Ländern von jüdischen und nichtjüdischen Organisationen gemeinsam organisiert und soll dazu dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser kennenzulernen.
Der Rundgang am Tag des offenen Denkmals widmet sich der kunst- und baugeschichtlichen Entwicklung auf beiden Seiten der damals neu gezogenen Grenze zwischen Deutsch-Oberschlesien und Polnisch-Oberschlesien. Anhand von sechs 3D-Modellen imposanter und repräsentativer Bauten, die zwischen 1922 und 1939 in der Region entstanden sind, wird deutlich, welche nationalpolitischen Ziele die jeweilige Seite mit ihren städtebaulichen Konzepten verfolgte. „Gerade die Erstellung der 3D-Modelle war aufwendig und nervenaufreibend, da uns nur der Pfarrer der St. Josefskirche in Hindenburg (Zabrze) alte Pläne zur Verfügung stellen konnte. Von den anderen fünf ausgewählten Bauwerken hatten wir keine Bestandspläne, aus denen wir CAD-Zeichnungen erstellen konnten. Hier musste sich der Konstrukteur mit Informationen aus historischem Material und dem Internet behelfen. Glücklicherweise gibt es z. B. ein 3D-Modell der Stadt Kattowitz (Katowice), das vom Vermessungsamt der Stadtverwaltung Kattowitz erstellt wurde und aus dem sogar die Abmessungen der Gebäude entnommen werden können. Für den Druck selbst konnten wir zwei Masterstudenten der Hochschule Rhein-Waal gewinnen, die in akribischer und langwieriger Kleinarbeit die einzelnen Komponenten druckten und zusammensetzten. Allein der Schlesische Sejm besteht aus 72 Einzelteilen. Aufgrund der Größe und Komplexität der Bauwerke kam ein kompletter 3D-Druck nicht in Frage“ erläutert der Museumsdirektor. Neugestaltung, Repräsentanz, Autonomie, Funktionalität – diese und weitere Aspekte werden während der Führung unter die Lupe genommen. Dem spannenden Feld architektonischer Rivalität ist im Katalog zur Ausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ ein eigenes Kapitel gewidmet. Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 bundesweit durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Der Aktionstag findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt.
Das Oberschlesische Landesmuseum lädt zur Eröffnung der Sonderausstellung „Dem Regiment zur Ehr, dem Vaterland zur Wehr. Preußische Regimenter in der Provinz Schlesien 1871–1914: Zwischen Militarismus und Alltagsleben“ am Sonntag, den 1. Oktober um 15 Uhr ein. Neben einer einleitenden Podiumsdiskussion wird an diesem Tag die erste von vielen öffentlichen Führungen angeboten. Der Eintritt ist frei.
Die Sonderausstellung bündelt einen beeindruckenden Bestand preußischer Militärkultur in Schlesien aus der Zeit zwischen der Reichsgründung und dem Ersten Weltkrieg. Die Schau präsentiert rund 700 Exponate aus der Sammlung von Norbert Kozioł aus dem oberschlesischen Peiskretscham (Pyskowice), der in mehr als vier Jahrzehnten Dutzende Originaluniformen und Reservistengegenstände zusammentrug. Die Einmaligkeit dieser Kollektion besteht darin, dass sich nach 1945 kein Museum im nunmehr polnischen Oberschlesien um die Objekte des „preußischen Militarismus“ kümmerte. Es ist davon auszugehen, dass Tausende von Objekten dieser Art verloren gegangen sind, teilweise sogar gezielt vernichtet wurden. Auch in Deutschland sind Artefakte der preußischen Militärkultur jener Zeit aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten rar. Dabei waren allein in der Provinz Schlesien, die die Regierungsbezirke Liegnitz (Legnica), Breslau (Wrocław) und Oppeln (Opole) umfasste, zwei Armeekorps und mehr als dreißig verschiedene Regimenter und Bataillone stationiert.
Die Ausstellung ist aber keine reine Sammlungspräsentation. Sie zeigt die Durchdringung des zivilen Alltags durch das Militärische, die Omnipräsenz des Militärs in der Gesellschaft, die autoritären Züge des Militärs, die sich negativ auf die deutsche Gesellschaft auswirkten. Auch die Ambivalenz des Militärs wird thematisiert: einerseits Stütze des Reiches, andererseits Drohformation gegen Andersdenkende. Die Rekonstruktion dieser schlesischen Armeewelt bietet die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Irrwegen der deutschen Geschichte. „Diese negative Entwicklung des deutschen ‚Sonderweges‘ wird in der Ausstellung besonders deutlich“ – so Museumsdirektor Dr. David Skrabania. „Am Anfang der Ausstellung ist die großformatige Aufnahme des Breslauer Rings mit dem Denkmal des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. hoch zu Pferd und in Uniform zu sehen. Am Ende eine rund 40 Jahre jüngere Aufnahme: Das Denkmal des Königs steht noch, nur die Häuserzeile im Hintergrund liegt in Trümmern. Es ist das Jahr 1945, die Festung Breslau ist gefallen, die schlesische Hauptstadt zu 85 Prozent zerstört, und auch die Königsskulptur wird bald verschwinden, wie die meisten deutschen Spuren. Aus dem deutschen Breslau wird das polnische Wrocław, die einheimische deutsche Bevölkerung muss die Stadt zwangsweise verlassen. Der deutsche/preußische Militarismus endet in einer totalen Katastrophe, die auch den plötzlichen Verlust Schlesiens an Polen mit sich bringt“ – fügt er hinzu.
Die Ausstellung wird von einer Publikation begleitet und entsteht in einem deutsch-polnischen Team unter der kuratorischen Leitung von Zbigniew Gołasz, Norbert Kozioł und Dr. Sebastian Rosenbaum sowie unter wissenschaftlicher Mitarbeit und gutachterlicher Beratung von Dr. Grzegorz Bębnik, Marius Hirschfeld, Dr. Frank Mäuer und Dr. David Skrabania.
Als Ergebnis der internationalen Tagung des Oberschlesischen Landesmuseums, die sich anlässlich des 100-jährigen Jahrestages im Jahr 2021 mit der Volksabstimmung in Oberschlesien befasste, und um die gewonnenen Ergebnisse zu bündeln, präsentieren die Herausgeber David Skrabania und Sebastian Rosenbaum die Publikation „Die Volksabstimmung in Oberschlesien 1921: Nationale Selbstbestimmung oder geopolitisches Machtspiel?“. Das Buch ist Mitte Mai als E-Book und am 7. Juli 2023 als Festeinband in der Reihe FOKUS – Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas im Brill Schöningh Verlag erschienen.
In sechs Teilen und in über dreißig Beiträgen geben Guido Hitze, Ryszard Kaczmarek, Juliane Haubold-Stolle, Bernard Linek, Jörn Leonhard, Karsten Eichner, Evelyne Adenauer, Sascha Hinkel, Piotr Pałys, Maciej Fic, Benjamin Conrad, James Bjork, Zbigniew Gołasz, Lutz Budrass, Andrzej Michalczyk, Mirosław Węcki, Grzegorz Bębnik, Matthias Lempert, Jakub Grudniewski, Marek Jurkowski, Beniamin Czapla, Dawid Smolorz, Jiří Neminář, Bartholomäus Fujak, Florian Paprotny, Grażyna Szelągowska, Wilhelm Wadl, Áron Máthé und die beiden Herausgeber einen umfassenden Blick auf das Thema. Dazu gehören neben dem Forschungsstand auch die bestehenden Erinnerungskulturen, die internationalen Aspekte der Situation Oberschlesiens nach 1918, die gesellschaftliche Stimmung im Zuge des Volksabstimmungskampfes, die Mechanismen der Plebiszit-Kampagne sowie die Durchführung der Volksabstimmung und die Reaktionen darauf. Im letzten Teil werden Fallbeispiele aus anderen europäischen Regionen zum Vergleich herangezogen.
„Die Ereignisse der Jahre 1919 bis 1922 in Oberschlesien mit den Aufständen, der Volksabstimmung und letztlich der Teilung der Region bilden bis heute einen wunden Punkt in der deutsch-polnischen Geschichte. Auch nach 100 Jahren ist die Beschäftigung mit der Thematik bisweilen sehr emotional. Sichtbar wird auch die unterschiedliche Erinnerungskultur an diese Ereignisse, und zwar nicht nur in Bezug auf die Intensität des Gedenkens, das in Deutschland inzwischen nicht mehr sehr ausgeprägt ist – im Gegenteil zu Polen, sondern auch im Hinblick auf die Schwerpunktsetzung, die in Polen klar auf dem Abstimmungskampf und den Aufständen liegt (…) Die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit bei diesem schwierigen Thema ist ein Gradmesser für eine immer besser werdende wissenschaftliche Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte und das Verständnis der jeweils anderen Position“, lobt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Haus Oberschlesien, Sebastian Wladarz, in seinem Vorwort.
Die Publikationsserie des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften präsentiert wissenschaftliche Monografien und herausragende Sammelbände mit neuesten Forschungen zur Geschichte Polens und Osteuropas. Die Publikationen verbinden Perspektiven der verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen bei der Betrachtung der Vergangenheit der Region. Obwohl der thematische Schwerpunkt der Reihe auf Polen und Osteuropa liegt, ist es das Ziel der Herausgeber, diesen Teil Europas in einen breiteren Forschungskontext zu stellen und damit auch einen Beitrag zur deutsch-polnischen Beziehungs- und Erinnerungsgeschichte zu leisten.
Pro Ukraine e. V. und die Stiftung Haus Oberschlesien laden am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr zu einem Jubiläums-Benefizkonzert in die Bahnhofstraße 71 in Ratingen-Hösel ein. Mit Musik aus und für die Ukraine wird das 20-jährige Bestehen und die tatkräftige Arbeit des Vereins gewürdigt. Auf der Bühne stehen Svetlana Novak, Olena Hizimchuk, Julia Khabyuk und weitere Überraschungsgäste. „Der Eintritt ist frei. Und wenn Sie können, bringen Sie bitte fünf Gäste mit“, wirbt die Vorsitzende von Pro Ukraine e. V., Vera Kostiuk Busch. Wer eine Vyshyvanka besitzt, wird herzlich ersucht, sie an diesem Tag zu tragen. Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf Iryna Shum.
Starke Frauen und starke Stimmen lautet das Motto des Nachmittags. Und so nimmt uns Julia Khabyuk, die derzeit in Köln Medizin studiert, mit dem ukrainischen Volksinstrument Bandura und ihrer glasklaren Stimme mit auf eine musikalische Reise rund 2000 Kilometer gen Osten. Die sogenannte „ukrainische Lautenzither“ ist auch das Musikinstrument von Svetlana Novak, die bis 2014 in Donezk lebte und wegen der Kämpfe im Donbass mit ihrer Familie nach Dnipro fliehen musste, wo sie im März 2022 erneut alles zurücklassen musste. Novak ist Bandura- und Gesangslehrerin und hat in Bochum einen Chor aus geflüchteten ukrainischen Müttern und ihren Kindern gegründet, der nun sein einjähriges Bestehen feiert. Auch Olena Hizimchuk aus Charkiw, die mit dem höchsten Ehrentitel „Volkskünstlerin der Ukraine“ ausgezeichnet wurde, widmet sich beidhändig dem 60-saitigen Instrument.
Pro Ukraine e. V. ist ein staatlich anerkannter, gemeinnütziger Verein zur Förderung einer freien und demokratischen Ukraine in einem vereinten Europa. Seit 20 Jahren engagiert sich der Verein in der Förderung der Demokratiebewegung, der Weiterbildung von Leistungsträgern – u. a. durch die Vergabe von Stipendien und die Organisation von Studienreisen – und der humanitären Hilfe durch das Sammeln von Hilfsgütern und Spenden. Aktueller Schwerpunkt des Vereins ist die Linderung der humanitären Katastrophe für Kinder in der Ukraine, die von dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands besonders betroffen sind. Pro Ukraine e. V. ist der älteste eingetragene ukrainische Verein NRWs.
Übrigens: Raten Sie mal, wo der Verein 2013 sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat? Und wenn Sie jetzt Stiftung Haus Oberschlesien geantwortet haben, dann liegen Sie richtig.
Im Jahr 2023 feiert das Oberschlesische Landesmuseum ein doppeltes Jubiläum: 40 Jahre seit seiner Errichtung und 25 Jahre seit der Eröffnung des Museumsneubaus. In einer thematischen Sonderausstellung geht es ab dem 16. Juli auf eine historische Spurensuche und 1000 Kilometer westwärts (aus der oberschlesischen Perspektive). In zeitlicher Chronologie geht der Ausstellungsmacher Marton Szigeti auf die Vorgeschichte, die Gründung und den Neubau ein und stellt das moderne Selbstverständnis dieses kulturgeschichtlichen Museums vor. Anschaulich illustriert durch Fotografien und Objekte aus der museumseigenen Sammlung, geben seine Textbeiträge Antworten auf die so oft gestellte Frage, wie es dazu kam, dass Oberschlesier in Nordrhein-Westfalen beheimatet sind.
„Am 6. Februar 1945 meldete die New York Times, dass Polen die Zivilverwaltung der ehemaligen Reichsgebiete ostwärts der Oder-Neiße-Linie übernommen habe. Spätestens mit der endgültigen Einstellung der Kampfhandlungen und der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 begannen die unkontrollierten Vertreibungen der deutschen Bevölkerung aus den ehemaligen östlichen Provinzen. Um der bevorstehenden Zwangsaussiedlungswelle Herr zu werden, organisierte die britische Rheinarmee mit der „Operation Swallow“ einen logistischen Kraftakt. Ohne jegliche Unterstützung der anderen drei alliierten Mächte wurden ab dem 28. Februar 1946 bis zu 4.000 schlesische bzw. oberschlesische Flüchtlinge pro Tag mit Güterwaggons Richtung Westen transportiert. So kamen bis zum Sommer 1947 über 1.360.000 Menschen in die britische Besatzungszone und damit auch in das spätere Nordrhein-Westfalen. Für den Wiederaufbau zerbombter Infrastruktur wurde jede Hand, die anpacken konnte, benötigt“, schreibt Szigeti einleitend.
Die Vertriebenen suchten aber auch Trost und Seelenfrieden im Kreise ihrer Schicksalsgenossen, neben den alltäglichen Existenz- und Zukunftssorgen. Mit dem Ende des Koalitionsverbotes durch die Westalliierten 1948 und der Zulassung von Vertriebenenverbänden wurde es möglich, sich zu organisieren. So stand 1949 der Gründung der Landsmannschaften nichts mehr im Wege. Im Jahr 1953 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Der umgangssprachlich als „Kulturparagraf“ bezeichnete § 96 des Gesetzes wurde zur zentralen Rechtsgrundlage für die Förderung von Kultureinrichtungen mit Bezug zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Als Ausdruck der langjährigen Verbundenheit des Landes mit den Oberschlesiern, von denen viele bereits in den 1870er Jahren als Bergleute ins Ruhrgebiet gekommen waren, übernahm das Land Nordrhein-Westfalen 1964 die Patenschaft für die in der Bundesrepublik lebenden Oberschlesier. Daraufhin wurde nach einem geeigneten Standort für ein Kulturzentrum der Oberschlesier im Raum Düsseldorf gesucht. Bis zur Einweihung des ersten Hauses am 11. März 1983 und der Eröffnung des Museumsneubaus am 16. Juli 1998 folgten viele spannende Etappen, zu denen vor allem die Gründung der Stiftung Haus Oberschlesien am 4. Dezember 1970 gehört. Nach der Bundestagswahl 1998 ging mit dem Wechsel zur rot-grünen Bundesregierung eine Neustrukturierung der Kulturförderung nach § 96 BVFG einher, die den Verzicht auf den Museumsstandort Ratingen zur Folge haben sollte. Nach Protesten und zusichernden Worten des Ministerpräsidenten des Patenlandes Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, der am 3. März 2000 verkündete: „Der Bestand des Museums ist gesichert. Das Haus Oberschlesien bleibt in Ratingen. Es aus dieser Region herauszunehmen, ist Unsinn“, war der Fortbestand des Hauses gewährleistet. Zuletzt übernahm das Land Nordrhein-Westfalen die institutionelle Förderung ab dem Jahr 2002.
„Diese kurze chronologische Einordnung gibt – wie so oft – nicht die Beweggründe und Anstrengungen der Einzelnen wieder“, betont die Pressesprecherin Katarzyna Lorenc und verweist auf die entgeltfreie Sonderführung des Kurators am Eröffnungstag (Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr), bei der ausdrücklich dazu eingeladen wird, alle mitgebrachten Fragen loszuwerden, aber auch die eigenen Erinnerungen im Besucherbuch festzuhalten. „Zahlen und geschichtliche Fakten sind hier nur eine Grundlage für den Austausch, auf den sich das ganze Team freut“.
25 Jahre Museumsneubau bedeutet im Juli 2,50 Euro Eintritt. Nutzen Sie den Jubiläumsrabatt und lernen Sie das Oberschlesische Landesmuseum im Juli (noch) besser kennen.
Das Programm des Oberschlesischen Landesmuseums für das dritte Vierteljahr ist prall gepackt. Hier ein Überblick.
Als Journalistenteam investigativ ermitteln und spielerisch in die Geschichte und Kultur Oberschlesiens eintauchen? In den Escape Rooms des Oberschlesischen Landesmuseums (OSLM) ist das ab Herbst 2022 möglich. Nun bietet das OSLM in den Sommerferien jeden Mittwoch vom 5. Juli bis 2. August ein betreutes Spiel- und Rätselvergnügen an. Die jungen Gäste (9-16 Jahre) werden vom Museumsteam begleitet und angeleitet, ohne zu viel zu verraten. Mögliche Startzeiten: jeweils um 13, 15 und 17 Uhr. Nur mit Anmeldung unter vermittlung@oslm.de
25 Jahre Museumsneubau bedeutet im Juli 2,50 Euro Eintritt. Nutzen Sie den Jubiläumsrabatt und lernen Sie das Oberschlesische Landesmuseum (noch) besser kennen.
Wer tiefer in die Geschichte des Museums eintauchen möchte, sollte an der Kuratorenführung anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung „40 Jahre OSLM“ am Sonntag, 16. Juli um 15 Uhr teilnehmen. Eine historische Spurensuche ist angesagt. In zeitlicher Chronologie geht der Kurator Marton Szigeti auf die Vorgeschichte, die Gründung und den Neubau ein und stellt das moderne Selbstverständnis des kulturhistorischen Museums vor. Anschaulich illustriert mit Objekten aus der museumseigenen Sammlung geben seine Textbeiträge Antworten auf die oft gestellte Frage, wie die Oberschlesier nach Nordrhein-Westfalen kamen.
Kreativ werden kann man im August bei gleich drei Angeboten. Beim Songwriting-Workshop mit Martell Beigang am Sonntag, 13. August (12-16 Uhr) werden eigene Lieder produziert. Der Workshop vermittelt neben den Grundlagen des Songwritings auch die technische Seite, denn die entstandenen Texte werden professionell bearbeitet und vertont. Beim Termin am Sonntag, 27. August (13-17 Uhr) geht es um das beliebte Handlettering. Gemeinsam mit Maia Kesseler ist ein Eintauchen in die Technik und ein Experimentieren mit kreativen Methoden, Sprache und Schrift möglich. Neben etwas Theorie und individuellen Übungen werden in diesem Workshop auch verschiedene Stifte und Zeichenstile erprobt. Beide Kunstworkshops richten sich an Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren. Sie sind kostenlos, da sie im Rahmen des Kulturrucksacks NRW angeboten werden. Ohne Altersbeschränkung wird am Samstag, den 26. August (14-16 Uhr), ein Aquarellmalerei-Workshop mit Mauga Houba-Hausherr angeboten. Der Wasserfarben-Crashkurs findet anlässlich der Ausstellung „Zwei Mal Heimat – An Rhein und Oder” statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro pro Person. Für alle Workshops ist eine Anmeldung unter vermittlung@oslm.de erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.
Der September steht ganz im Zeichen der Rundgänge.
Am Europäischen Tag der jüdischen Kultur (3. September, 15 Uhr) führt Dr. Frank Mäuer durch die Sonderausstellung „Jüdische Spuren. Von der Synagoge zum Gebetshaus in Beuthen“; am Tag des offenen Denkmals (10. September, 15 Uhr) stellt Dr. David Skrabania die Architektur Oberschlesiens um 1922 vor. Am 14. September um 18 Uhr spricht Prof. Peter A. Kraus von der Universität Augsburg über den baskischen und katalanischen Separatismus. An diesem Tag (aber auch am 6. Juli, 20. Juli und 3. August) werden öffentliche Führungen zur Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ angeboten. Am Freitag, 29. September, 18-23 Uhr, kehrt die neanderland MUSEUMNACHT zurück. Das Oberschlesische Landesmuseum lädt zu einer fünfteiligen Entdeckungsreise ein. Unter den Überschriften Wo liegt Oberschlesien? Wer kommt aus Oberschlesien? Wie schmeckt Oberschlesien? und Wie klingt Oberschlesien? (mit einem Foyerkonzert von Frela Blue) wird die Kultur Oberschlesiens hautnah vermittelt.
Das Oberschlesische Landesmuseum feiert am Samstag, 17. Juni, von 14.30 bis 21 Uhr sein alljährliches Sommerfest. Geboten werden musikalische Live-Acts, kreative Workshops für alle Altersgruppen und abwechslungsreiche Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen. Auf der Bühne des Außengeländes treten bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen das Oberschlesische Blasorchester Ratingen, die Theater-AG der Wilhelm-Busch-Schule, der Höseler Gospelchor Voices of freedom, Frela Blue Banda und Line-Out auf.
Musikalische Streifzüge
Den musikalischen Auftakt macht das 1982 gegründete Oberschlesische Blasorchester. Die Musikerinnen und Musiker unterschiedlichen Alters kommen aus verschiedenen Orten Nordrhein-Westfalens und sind zu 80 Prozent gebürtige Oberschlesier. Das Repertoire unter der Leitung des Dirigenten Andreas Bartylla ist stilistisch breit gefächert. Hierzu gehören klassische Werke, Choräle, Musikstücke aus Musicals, traditionelle Volksmusik, Schlager, moderne Jazz- und Swinginterpretationen sowie eigene Arrangements. Anschließend feiert ein Theaterstück der Höseler Wilhelm-Busch-Schule Premiere. In Anlehnung an das Bilderbuch „Die große Frage“ widmen sich die jungen Theateradepten der Frage: Warum bin ich auf der Welt? „Alle Ideen, Inhalte und Texte zu diesem Theaterstück stammen von den Kindern der Klasse 2a (Walklasse) der Wilhelm-Busch-Schule in Hösel“ – verrät die betreuende Lehrerin Julia Schubert.
Es ist wahrlich ein Jahr der Jubiläen. Während das Oberschlesische Landesmuseum sein 40-jähriges Bestehen und den Einzug in das neue Gebäude in der Bahnhofstr. 62 vor 25 Jahren feiert, wird der Höseler Gospelchor Voices of Freedom unter der Leitung von Carmen Camara 20 Jahre jung. Mit Stimmen der Freiheit werben sie ab 16:30 Uhr buchstäblich für ein musikalisches Miteinander – zwischen christlicher Gospelmusik und weltlicher Popmusik – und geben einen Vorgeschmack auf das Jubiläumskonzert im Herbst im Haus Oberschlesien, wo auch regelmäßig geprobt wird. Ab 18 Uhr wird kräftig gemixt, denn die Frela Blue Banda steht für schlesischen Blues mit raffinierten Pop-, Soul-, Jazz- und Funk-Aromen. Alex Stegh singt auf Deutsch, Schlesisch, Polnisch, Englisch und… Portugiesisch, spielt Gitarre, textet und komponiert. Begleitet wird sie von Achim Rzychoń am Bass, Arek Błeszyński an der Sologitarre und Ismail Tarlan an der ägyptischen Darbuka. Gegen Ende des Abends wird es rockiger. Die Essener Rock & Pop Coverband Line Out sorgt ab 19.45 Uhr für den passenden Ausklang des Sommerfestes. Eine Zeitreise mit einem tollen Mix aus 80er, 90er bis hin zu aktuellen Hits ist garantiert!
Mitmachen und Mitnehmen
Unter der Überschrift „Mitmachen und Mitnehmen“ ist genau das geboten: Es warten Workshops, Lernangebote und Gewinne auf die Besucherinnen und Besucher. In der offenen Papierwerkstatt mit der Ratinger Künstlerin Petra Richter-Rose – Kommen und Gehen jederzeit möglich – kann unabhängig vom Alter in die Vielfalt dieses faszinierenden Materials eingetaucht werden. Indem Papier geschnitten, gedreht, gefaltet und gebogen wird, wird es verändert, erweitert, verbunden und neu zusammengesetzt. Alle entstandenen Kreationen können selbstverständlich mitgenommen werden. Die Künstlerin bietet zudem eigene Werke zum Verkauf an. Während drinnen Papier verarbeitet wird, können bis zu fünfzehn Kinder gleichzeitig mit Holz experimentieren. In der mobilen Werkstatt von Basti Bus darf mit Schraubstock und vorgefertigten Holzrohlingen mit Feile, Raspel, Hammer, Schmirgel- und Schleifpapier unter Anleitung eines erfahrenen Basti-Bus-Betreuers nach Herzenslust gewerkelt werden. In mehreren Kurzführungen erzählt das Team außerdem von den musealen Lieblingsstücken und den Geschichten, die sich dahinter verbergen, und widmet sich den nicht immer leicht durchschaubaren Fragen des Sammelns und Inventarisierens. Bei der Tombola warten tolle Preise: von Freikarten für die Escape Rooms bis hin zu ausverkauften Raritäten aus dem Museumsshop. „Nachbarschaftlich, regional und schlesisch wird das Sommerfest am 17.6. Das gesamte Team freut sich auf Stammgäste und neue Gesichter“, betont die Pressesprecherin Katarzyna Lorenc.
Mit schlesischen Backspezialitäten der Bäckerei Artur Müller, kühlen Getränken der Bar in Motion und leckerem Eis von Silvios Eistaxi wird das kulturelle Angebot gastronomisch abgerundet. Da sich der Museumsparkplatz in eine Kultur- und Gastronomiemeile verwandelt, empfehlen die Veranstalter, das Auto in den umliegenden Straßen oder zu Hause stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. Das Sommerfest wird neben den vielen helfenden und engagierten Mitwirkenden auch von den Stadtwerken Ratingen und dem Polregio e.V. unterstützt. Der Eintritt ist frei.
Mehr über das Wer, Was, Wann erfahren Sie hier:
https://oberschlesisches-landesmuseum.de/sommerfest/
Es ist Halbzeit für die vertiefende Vortragsreihe, die als Begleitprogramm zur Ausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ angelegt ist. Der Regensburger Historiker Dr. Konrad Clewing spricht am Donnerstag, den 15. Juni, um 18.30 Uhr über Staatszerfall und Staatsbildung durch Krieg. Als Beispiele werden Bosnien-Herzegowina und Kosovo herangezogen. Eine Führung durch die Sonderausstellung mit dem Museumsdirektor und Ko-Kurator Dr. David Skrabania um 17 Uhr (Kosten: Eintritt plus zwei Euro) ist ebenfalls sehr zu empfehlen.
Der Vortrag beschreibt an zwei konkreten Fällen, wie der Krieg als Mittel der Politik in den 1990er Jahren eine erste Rückkehr nach Europa erlebte. Das titoistische Jugoslawien hatte an sich, zumindest für seine Teilrepubliken, eine klare verfassungsrechtliche Regelung für die friedliche Abwicklung eines möglichen Staatszerfalls. Inmitten der inneren Systemkrise und der geopolitischen Umwälzungen von 1989/90 wurden jedoch vor allem von serbischen Akteuren die Grundlagen für die Anwendung kriegerischer Gewalt gelegt. „Der internationale Kontext, der beide Fälle über das westliche Konzept der Multiethnizität verbindet, wird ebenso beleuchtet wie die Gewaltdynamik, die zwei von Belgrad nicht gewollte Staatenbildungen, Bosnien-Herzegowina und Kosovo, hervorgebracht hat“, unterstreicht Clewing in seinem Exposé. Überdies betont Skrabania die Bedeutung der theoretischen Verankerung der Gastvorträge. „Warum behandeln wir diese Themen hier? ‚Grenzgänger‘ ist eine Ausstellung über die Zeit der Teilung Oberschlesiens zwischen Deutschland und Polen von 1922 bis 1939. Und anhand dieser Ausstellung kann man noch viel mehr zeigen, nämlich andere europäische Konflikte auf ethnisch-nationaler Ebene vergleichend darstellen. Zum Beispiel den Jugoslawien-Konflikt, der heute mit Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo in gewisser Weise wieder aufzuflammen scheint“, bringt er ein.
Dr. Konrad Clewing ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Regensburg). Clewing studierte von 1986 bis 1992 Geschichte und Volkswirtschaftslehre in München, Wien und Zagreb. Er promovierte 1997 in München über das Vordringen der habsburgischen Staatlichkeit in die Gesellschaft Dalmatiens und die dadurch ausgelösten Nationsbildungsprozesse. Von 1997 bis 2007 war er Redakteur der Südost-Forschungen am Südost-Institut (SOI). Von 2006 bis Ende 2011 war er stellvertretender Direktor des SOI und mitverantwortlich für die wissenschaftliche Ausrichtung am neuen Standort Regensburg. Seit 2006 ist er gemeinsam mit dem jeweiligen Institutsdirektor Herausgeber der Südost-Forschungen und der Südosteuropäischen Arbeiten, seit 2010 zudem Mitherausgeber des Handbuchs zur Geschichte Südosteuropas. Aktuell (seit 2018) koordiniert er zudem die Beiträge des IOS im Rahmen der Reihe digiOst.
Eine zweitägige internationale Tagung des Oberschlesischen Landesmuseums widmet sich am 2. und 3. Juni 2023 dem Vergleich zwischen den Regionen Rheinprovinz und Provinz Oberschlesien. Historischer Ausgangspunkt ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Mit Referenten wie Guido Hitze (Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen), Martin Schlemmer (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen), Bernard Linek (Schlesisches Institut Oppeln/Opole), Andrzej Michalczyk (Ruhr-Universität Bochum), Stefanie van de Kerkhof (Universität Mannheim), Antje Johanning-Radžienė (Herder-Institut), Juliane Haubold-Stolle und Peter Polak-Springer (Europa-Universität Viadrina) und weiteren Gästen werden einzelne Themenkomplexe aufgezeigt und mit dem Publikum diskutiert. Politische Herausforderungen, Wirtschaft, Religion und Gesellschaft sowie Erinnerung und Identität stehen dabei im Mittelpunkt. Die Tagung ist für die Öffentlichkeit zugänglich und gebührenfrei. Um Anmeldung unter anmeldung@oslm.de wird gebeten.
Auf die Frage, warum sich ein Vergleich dieser beiden Regionen anbietet, antwortet der Organisator und wissenschaftliche Mitarbeiter des Oberschlesischen Landesmuseums, Frank Mäuer: „Zunächst einmal fällt auf, dass in beiden Regionen nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich ‚keine Ruhe einkehrte‘. In Oberschlesien bewegte die Frage der künftigen staatlichen Zugehörigkeit die Gemüter, im Westen die Besetzung der linksrheinischen Gebiete und einiger rechtsrheinischer Brückenköpfe. Der Grad der politischen Mobilisierung der Bevölkerung blieb durchgehend hoch. Nicht selten schlug die politische Auseinandersetzung auch in Gewalt um. Als spezifische Grenzräume ergaben sich für das Rheinland und Oberschlesien aus dem verlorenen Weltkrieg besondere Herausforderungen, die sie von anderen Regionen im Deutschen Reich unterschieden.“
Die Tagung bringt ausgewiesene Fachleute zusammen und bietet ihnen ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch in einem überregionalen Rahmen. „Durch den vergleichenden regionalhistorischen Blick steht zu hoffen, dass neue wechselseitige Perspektiven für die Forschenden auf das jeweils eigene Forschungsfeld eröffnet werden und auch überregional neue Gesichtspunkte für die Geschichte des Gesamtstaates im Zusammenhang mit der Chiffre ‚1923‘ offengelegt werden. Nicht zuletzt sind die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Oberschlesien zwischen 1919 und 1922 sowie der ab 1923 beginnende ‚Ruhrkampf‘ auch im Kontext eines über 1918 hinaus fortdauernden europäischen Konfliktes zu sehen. Den Blick auf diesen Aspekt erneut zu schärfen, ist auch ein Ziel dieser Tagung“, so Mäuer weiter.
Die Tagung ist eine Begleitveranstaltung zur aktuellen Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ und wird im Rahmen des EU-Projektes StadtRäume/UrbanSpaces live im Internet übertragen. Sie wird in Kooperation mit dem Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. und dem Opladener Geschichtsverein von 1979 e. V. Leverkusen durchgeführt. Mitveranstalter ist die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen.
Auf der Website des Museums finden Sie das Tagungsprogramm https://oberschlesisches-landesmuseum.de/veranstaltungen/tagung/. Darüber hinaus steht auf dem YouTube-Kanal des Museums (https://www.youtube.com/user/oslmRatingen) ein Einführungsinterview zwischen Frank Mäuer und Marius Hirschfeld zur Verfügung.
Bereits zum dritten Mal laden die Stiftung Haus Oberschlesien und das Oberschlesische Landesmuseum Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft nach Ratingen-Hösel ein. Bei der Podiumsdiskussion am 23. Mai treffen Julia Chenusha, Prof. Norbert Bolz und Dr. Andreas Hollstein aufeinander. Moderiert wird die Gesprächsrunde vom langjährigen WELT-Korrespondenten Boris Kálnoky. Ziel des 2021 ins Leben gerufenen Formats ist es, aktuelle Themen multiperspektivisch zu diskutieren.
„Der Ukraine-Krieg und seine Folgen haben die größte Hoffnung der Nachkriegszeit zerstört: Wandel durch Handel“, so der einleitende Kommentar von Prof. Bolz. „Am Tag des Grundgesetzes werden wir daran erinnert, dass wir in Deutschland in Freiheit und Frieden leben. Dieses Recht wurde den Menschen in der Ukraine durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriff über Nacht genommen. Deshalb ist es ein guter Tag, Debatten zu Themen zu führen, die dramatische Auswirkungen auf Europa und damit auch auf unser Land haben“, unterstreicht Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz. Im Mittelpunkt stehen daher diesmal die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven der Ukraine (EU- und NATO-Erweiterung, internationaler Schutzstatus, Wiederaufbau) und die mediale Berichterstattung, also der „Krieg in den Medien“. „Dabei darf es durchaus kontrovers zugehen“ – sagt der Direktor des Oberschlesischen Landesmuseums, Dr. David Skrabania, und plädiert für mehr Streitkultur auf dem Podium. „Zunehmend beobachtet man Gleichgesinnte in den Diskussionsrunden, die mit gegenseitiger Bestätigung beginnen und mit Kopfnicken enden.“
Die Podiumsdiskussion am 23. Mai bietet Gelegenheit zu einer facettenreichen Debatte. „Mit Prof. Norbert Bolz haben wir jemanden, der die mediale Seite der Berichterstattung in Deutschland und Europa zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine beleuchten kann. Julia Chenusha ist als Ukrainerin direkt betroffen und als Geschäftsführerin des Blau-Gelbes Kreuzes unmittelbar in die Hilfe für die Kriegsopfer involviert. Dr. Andreas Hollstein wiederum hat den Blick auf Polen als wichtigstes Grenzland zur Ukraine und ist ein ausgewiesener Experte für Integrationspolitik“, begründet Skrabania die Auswahl der Gäste. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr. Fragen aus dem Publikum sind nicht nur willkommen, sondern explizit erwünscht. Der Eintritt beträgt 5 Euro (Abendkasse). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Während die einen in den Mai tanzen, begleiten Sie am 29. April um 18 Uhr „Schumann und schlesische Schumannianer“ mit Andreas Post (Tenor) und Dominikus Burghardt (Klavier) in den fünften Monat des Jahres. Die musikalische Veranstaltung ist eine Fortsetzung der Konzertreihe „Salon Silesia – Musik aus und rund um Schlesien“ des Oberschlesischen Landesmuseums.
Unter dem Begriff „schlesische Schumannianer“ werden vor allem Komponisten des 19. Jahrhunderts – der Blütezeit des deutschen Kunstliedes – zusammengefasst. Sie waren entweder gebürtige Schlesier oder wirkten zu Lebzeiten maßgeblich in Schlesien. Unter ihnen befinden Komponisten wie Karl Heinrich Zöllner, Carl Koßmaly, Julius Stern, Robert Radecke und Arnold Mendelssohn. Namen, die heute größtenteils unbekannt oder vergessen sind, deren Liedkompositionen aber von großem Wert sind. Diese Komponisten gehörten zu erklärten Bewunderern Robert Schumanns. Er wiederum schätzte ihre Werke, die er nachweislich in der von ihm herausgegebenen „Neuen Zeitschrift für Musik“ positiv rezensierte. Das Konzertereignis am 29. April führt Kunstlieder von Zöllner, Koßmaly, Stern, Radecke und Mendelssohn erstmalig mit denen von Robert Schumann zusammen. Die Idee und Ausarbeitung des Programms lag in den Händen von Dominikus Burghardt.
Der Tenor Andreas Post studierte zunächst Schulmusik bei Prof. Soto Papulkas an der Folkwang Hochschule (jetzt Folkwang Universität der Künste) in Essen, wechselte dann aber zum Sologesang. Sein Examen legte er mit Auszeichnung ab. In Kursen bei Margreet Honig ergänzte und verfeinerte er seine Studien. 1998 erhielt der gebürtige Arnsberger einen zweiten Preis beim 11. Internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig sowie einen Sonderpreis des MDR. Seine rege Konzerttätigkeit führt den Stipendiaten des Richard-Wagner-Verbandes Köln immer wieder über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus, unter anderem nach Israel, Südafrika, in die Ukraine und nach Singapur. Er arbeitet mit renommierten Dirigenten wie Enoch zu Guttenberg, Sir Neville Marriner, Paul McCreesh oder Wolfgang Katschner und Ensembles wie der lautten compagney BERLIN, der Hannoverschen Hofkapelle oder der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Akademie sowie mit Chören wie dem Leipziger Thomanerchor oder den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben zusammen. Posts besonderes Engagement gilt seit vielen Jahren dem Kunstlied, dem er sich gemeinsam mit Dominikus Burghardt intensiv widmet. Zahlreiche CD- und Rundfunkproduktionen spiegeln sein breites Tätigkeitsfeld wider.
Der Pianist Dominikus Burghardt studierte an den Musikhochschulen in Essen bei Prof. Boris Bloch, in Düsseldorf bei Prof. David Levine und in Hannover bei Prof. Roberto Szidon. Als Liedpianist erhielt er entscheidende Impulse von Prof. Norman Shetler in Wien und Prof. Irwin Gage in Zürich. Seit vielen Jahren arbeitet er mit zahlreichen Liedsängerinnen und Liedsängern zusammen. Seine Konzerttätigkeit führte ihn auf bedeutende Podien und Festivals in Deutschland, im europäischen Ausland und in die USA. Über 25 Jahre lang unterrichtete er Liedgestaltung an verschiedenen Musikhochschulen in Deutschland, unter anderem in Leipzig, Dortmund und Essen. Außerdem leitete er Meisterkurse etwa an der Musikakademie in Kattowitz und an der Universität in Pula. 2015 initiierte er den Internationalen Liedduo-Wettbewerb Rhein-Ruhr. Heute lebt und arbeitet er in Würzburg.
Die Karten (15 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse) können online auf der Seite von NeanderTicket gebucht und sofort ausgedruckt oder an einer der bekannten Vorverkaufsstellen in der Region bezogen werden. Eine telefonische Bestellung unter (02102) 9650 ist ebenfalls möglich. Spielstätte ist das Haus Oberschlesien (Bahnhofstr. 71).
„Salon Silesia – Musik aus und rund um Schlesien“ bietet die Möglichkeit, ein breites Repertoire deutscher, polnischer, tschechischer und auch österreichischer Komponisten aufzuführen und verdeutlicht einmal mehr die völkerverbindende Kraft der Musik.
Mit einem Gastvortrag zum Thema „Nationsbildung durch Konflikt? Die ukrainischen Gebiete zwischen 1772 und 2022“ kommt am 27. April die renommierte Prof. Dr. Kerstin S. Jobst nach Hösel. Ihr Vortrag steht im Kontext der aktuellen Sonderausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums.
Schon bei der Konzeption der Ausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ war es den beiden Kuratoren, Dawid Smolorz und Dr. David Skrabania, ein Anliegen, die Teilung Oberschlesiens, die aus der Volksabstimmung von 1921 resultierte, als Exempel zu behandeln und ähnlich gelagerte Fragestellungen zu beleuchten. Dass sich das Begleitprogramm mit Themen und Konflikten außerhalb Oberschlesiens beschäftigte, verwundert daher nicht. Den zweiten Vortrag der begleitenden Vortragsreihe hält Prof. Dr. Kerstin Jobst von der Universität Wien. In ihrem Exposé skizziert Jobst ihre Ausführungen: „Historisch gesehen sind Nationen ein vergleichsweise junges Phänomen, während beispielsweise Reichsbildungen, religiöse oder regionale Vergemeinschaftungsformen historisch viel älter sind. Dies gilt auch für die heute von der Russischen Föderation völkerrechtswidrig als russisch beanspruchten Gebiete. Auch das neuzeitliche Phänomen der Nation bezog sich zunächst eher auf eine imaginierte Gemeinschaft als auf ein gefestigtes Gebilde. Die ukrainische Nation, lange Zeit wenig einheitlich und immer wieder umstritten, wird nun durch den Krieg endgültig vollendet.“
Die Veranstaltung am 27. April um 18:30 Uhr im Rahmen von Podium Silesia ist die zweite von insgesamt sechs Begleitveranstaltungen und findet im Haus Oberschlesien statt. Der Eintritt ist frei. Sehr zu empfehlen ist die vorgeschaltete Führung durch die Ausstellung mit dem Museumsdirektor um 17 Uhr (Kosten: Eintrittspreis zzgl. 2 Euro). „Wir sehen das Ausstellungsprojekt als historisches Beispiel für Grenzkonflikte im Europa des 20. Jahrhunderts, anhand dessen die Komplexität ethnischer Konflikte und die Möglichkeiten ihrer Beilegung und der Sicherung von Minderheitenrechten diskutiert werden können“ – erklärt Dr. David Skrabania. Ende April erscheint zudem ein Begleitband, der nicht nur die Inhalte der Ausstellung wiedergibt, sondern diese in sieben weiteren Beiträgen vertieft.
Kerstin Susanne Jobst (* 1963 in Hamburg) ist eine deutsche Historikerin und Universitätsprofessorin. Seit 2012 lehrt sie am Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geschichte Ostmittel- und Osteuropas, der Schwarzmeerregion, der Kaukasusregion und der Habsburgermonarchie; Vergleichende Imperiums- und Kolonialismusforschung; Religionsgeschichte und Hagiographie; Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik; Tourismusgeschichte des Östlichen Europas; Histories of Desaster/Katastrophenforschung.
Im Rahmen der Reihe »Litterae Silesiae« des Oberschlesischen Landesmuseums stellt Elina Penner am 19. April um 18:30 Uhr im Haus Oberschlesien ihren Debütroman »Nachtbeeren vor. Mit dem im März 2022 erschienenen Buch erntete die Autorin landesweites Kritikerlob. Der Eintritt (Abendkasse) kostet 5 Euro. Das Werk kann im Vorfeld während der Öffnungszeiten des Museums und am Abend selbst erworben werden.
Es sind nur wenige Tage – aufgeteilt zwischen Morgen- und Abendstunden im Mai 2010 und Mai 2020 – in denen die Geschichte von und um Nelli Neufeldt erzählt wird. Die Protagonistin nimmt uns – mal als Mädchen, mal als junge Ehefrau – mit auf eine livetickerartige Reise zu den persönlichsten Ereignissen ihres Lebens; Tod eines geliebten Menschen, frühe Schwangerschaft und schmerzhafte Trennung. Geprägt von Trauer, doch witzig und unverblümt, wird das Leben einer Frau erzählt, die einer russlanddeutschen Gemeinschaft entstammt und in eine ebensolche Familie eingeschlossen ist. Doch obwohl Penners Debütroman einen Einblick in die vermutlich wenig bekannte mennonitische Community gibt, wird er auch ohne diesen Bezug verstanden. Beerdigen und Bekehren, Sterben und Erinnern, Essen und Trinken… Ein Leben in Verben, die in »Nachtbeeren« zu Kapitelüberschriften werden. Das Buch ist zudem eine raffinierte Sprachsuche und eine Würdigung des Plautdietsch, das weltweit nur von etwa 500.000 Menschen gesprochen wird.
Elina Penner wurde 1987 als mennonitische Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion geboren und kam 1991 nach Deutschland. Plautdietsch ist ihre Muttersprache. Nach Jahren in Berlin und in den USA lebt sie mit ihrer Familie in Ostwestfalen.
Die Lesung findet als Rahmenprogramm zur aktuellen Wanderausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ statt, die noch bis zum 17. Juni im Oberschlesischen Landesmuseum zu sehen ist, und wird von Christian Sprenger (LmDR e. V.) moderiert.
Der (kalendarische) Frühling ist da und das Angebot des Oberschlesischen Landesmuseums ist nicht weniger abwechslungsreich als das aktuelle Wetter. Ab dem 1. April 2023 empfängt das Museum seine Gäste an fünf Tagen die Woche und zwar mittwochs bis sonntags, von 12 bis 19 Uhr. Für Schulen und Universitäten gelten überdies nach Absprache Sonderöffnungszeiten. Am Karfreitag bleibt das Museum geschlossen. Dafür öffnen sich die Türen am Ostermontag.
Mehrere Highlights prägen das Programm für die Monate April, Mai und Juni. Im April dürfen sich die Literaturfans auf die Lesung von Elina Penner freuen. In der zweiten Veranstaltung der Reihe „Litterae Silesiae“ in diesem Jahr stellt die Autorin am 19. April um 18:30 Uhr im Haus Oberschlesien ihren Debütroman „Nachtbeeren“ vor. Mit dem im März 2022 erschienenen Buch erntete Penner bundesweites Kritikerlob. Der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 5 Euro. Das Buch kann im Vorfeld während der Öffnungszeiten des Museums und am Abend selbst erworben und signiert werden. Während die einen in den Mai tanzen, begleiten uns am 29. April „Schumann und schlesische Schumannianer“ mit Andreas Post (Tenor) und Dominikus Burghardt (Klavier) in den fünften Monat des Jahres. Die Karten (15 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse) können online auf der Seite von NeanderTicket gebucht und sofort ausgedruckt oder an einer der bekannten Vorverkaufsstellen in der Region bezogen werden.
Mit zwei wissenschaftlichen Vorträgen, die im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ am 27. April und am 15. Juni gehalten werden, greift das Museum Themen auf, die über Oberschlesien hinausgehen. Während Prof. Dr. Kerstin Jobst von der Universität Wien zum Thema „Nationsbildung mittels Konflikt? Die ukrainischen Gebiete zwischen 1772 bis 2022“ referiert, beschäftigt sich Dr. Konrad Clewing vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung mit Staatszerfall und Staatsbildung durch Krieg am Beispiel von Bosnien-Herzegowina und Kosovo. Beide Vorträge beginnen jeweils um 18:30 Uhr und können mit einer vorgeschalteten Kuratoren-Führung durch die thematische Ausstellung verbunden werden (jeweils um 17 Uhr).
Am Internationalen Museumstag am 21. Mai lädt das Museum dazu ein, bei freiem Eintritt die Besonderheiten des Hauses zu entdecken. Darüber hinaus findet um 15 Uhr ein Zeitzeugengespräch mit dem Ehepaar Schüle statt, welches die Wanderausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ begleitet. Am Abend des 23. Mai widmen sich die mittlerweile dritten Höseler Gespräche dem Thema Ukraine. Unter der Moderation von Boris Kálnoky werden Lösungsansätze zur Beendigung des Krieges aufgezeigt und diskutiert. Eine zweitägige Tagung am 2. und 3. Juni mit der Überschrift „Konkurrierende Grenzräume im historischen Vergleich. Die Rheinprovinz und die Provinz Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg“ wirft ein vergleichendes Licht auf die dramatischen Nachkriegsjahre des Ersten Weltkriegs in Oberschlesien und im Rheinland. Die Konferenz ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. und Opladener Geschichtsverein von 1979 e. V. Leverkusen in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen.
Das Programm des jährlichen Sommerfestes, das in diesem Jahr am 17. Juni stattfindet, umfasst musikalische Live-Acts, kreative Workshops für alle Altersgruppen und facettenreiche Führungen durch Dauer- und Sonderausstellungen. Für das Oberschlesische Landesmuseum ist das Jahr 2023 ein besonderes Jahr, denn es markiert zwei Jubiläen – 40 Jahre OSLM und 25 Jahre Neubau. Am 16. Juli 1998 bezog das OSLM ein neu errichtetes, modernes Museumsgebäude in der Bahnhofstraße 62. Als Vorabinformation und aus gegebenem Anlass zahlen Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher im Juli nur 2,5 Euro Eintritt.
Nach Stationen im Odenwald, in Niederbayern und Niedersachsen – um nur einige zu nennen – eröffnet die Wanderausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwert“ am 26. März 2023 um 15 Uhr im Oberschlesischen Landesmuseum. Zur Begrüßung spricht Natalie Pawlik, seit April 2022 Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, als Ehrengast ist Kerstin Griese MdB, SPD-Abgeordnete für Niederberg und Ratingen und Parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales, anwesend. Die Eröffnung wird zudem durch eine von dem Journalisten Marius Reichert moderierte Diskussion eingeleitet. Auf dem Podium sitzen Irina Peter, Journalistin und Podcasterin, Edwin Warkentin, seit 2017 Leiter des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und Dietmar Schulmeister, Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. in NRW. Aleksandar Filić übernimmt die musikalische Begleitung mit Stücken von Nikolai Medtner und Alfred Schnittke.
Der historische Teil der Sonderausstellung befasst sich mit der Zeit zwischen 1763 und den Einwanderungsbewegungen der 1990er-Jahre. Der zeitgenössische Part informiert über bestehende Vorurteile und Klischees gegenüber der russlanddeutschen Minderheit und räumt mit ihnen auf. Anhand von Info-Tafeln, großen Wandkarten und Filmbeiträgen werden geschichtliche Ereignisse und individuelle Biografien von (Spät‑)Aussiedlerinnen und (Spät‑)Aussiedlern aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion erläutert.
„Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der öffentlichen Debatten in Deutschland sieht sich das Oberschlesische Landesmuseum in der Verantwortung, das Thema vielschichtig aufzugreifen und ihm ein Forum zu geben, um einerseits auf das Unrecht des russischen Angriffskrieges hinzuweisen, andererseits Missverständnisse und Vorurteile, mit denen die russlanddeutsche Gemeinschaft konfrontiert ist, auszuräumen und Verständnis für die schwierige Geschichte der Deutschen aus Russland zu wecken“, betont Museumsleiter Dr. David Skrabania. „Die Ausstellung behandelt nicht nur zentrale Aspekte der russlanddeutschen Geschichte, sondern gibt auch einen persönlichen Einblick in die Themen Vertreibung, Zuwanderung und Integration“, ergänzen die beiden Projektleiter Christian Sprenger und Dr.-Phil. Eugen Eichelberg.
Zum Rahmenprogramm der Ausstellung gehören eine Lesung mit Elina Penner aus ihrem Debütroman „Nachtbeeren“ am 19. April um 18:30 Uhr und ein Zeitzeugengespräch mit dem Ehepaar Schüle am Internationalen Museumstag, 21. Mai um 15 Uhr. Beim jährlichen Sommerfest und gleichzeitig letzten Ausstellungstag, am 17. Juni (15-21 Uhr) unterstützen die landsmannschaftlichen Orts- und Kreisgruppen Duisburg und Düsseldorf die Vermittlungsarbeit mit Informationsständen. Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland können die Ausstellung gegen Vorlage eines gültigen Dokuments unentgeltlich erkunden.
Die an die Räumlichkeiten des OSLM angepasste Schau entsteht in Kooperation mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. mit Sitz in Stuttgart und wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) gefördert.
Mit einem 3-in-1-Konzept lädt das Oberschlesische Landesmuseum am Internationalen Frauentag zu einer Führung durch die Sonderausstellung, einem Vortrag und einem Konzert ein. „Zur Beginn der 1870er Jahre kamen nachweislich die ersten Gruppen polnischer Arbeiter in das Ruhrrevier, konkret nach Bottrop. Das rheinisch-westfälische Ruhrgebiet wurde zum Sehnsuchtsort für Abertausende junge Männer (und mit der Zeit auch Frauen), die nicht nur nach einer Existenzsicherung, sondern auch nach einem besseren Leben strebten“, schreibt Dr. David Skrabania in dem kürzlich erschienenen Buch „Geschichte der Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen“ (Hrsg. Carmen Teixeira, Dietz Verlag). Und genau dieser – hier in Klammern genannten – Gruppe widmet er seinen Vortrag. Unter der Überschrift „Ruhrpolinnen. Frauen in den Migrationsprozessen aus den preußischen Ostprovinzen an Rhein und Ruhr um 1900“ und mit einer anschließenden Fragerunde geht es darum, diese keineswegs homogene Gruppe zu porträtieren. „Die Integrationstendenzen unter der ruhrpolnischen Bevölkerung nahmen mit der Aufenthaltsdauer im Ruhrrevier, mit der Geburt von Kindern und dem wachsenden behördlichen und teils auch gesellschaftlichen Druck zu. Häufig waren es die Frauen – in aller Regel aus den Herkunftsgebieten ihrer Ehemänner stammend – die zu den Antriebsmotoren der Integration wurden“ – heißt es weiter in seinem Beitrag. „Lange Zeit galt die Migration als ein männliches Phänomen. Doch Frauen haben damals wie heute am Migrationsprozess teilgenommen“, ergänzt Joanna Szymańska, wissenschaftliche Leiterin des Info Forum Polregio. Das Angebot des Oberschlesischen Landesmuseums am 8. März findet in Kooperation mit dem Aachener Verein statt und ist kostenfrei. Im Anschluss an den wissensvermittelnden Teil des Mittwochnachmittags gibt es etwas für Augen und Ohren. Im Veranstaltungssaal im Haus Oberschlesien, in dem derzeit eine Ausstellung der Malerin Mauga Houba-Hausherr zu sehen ist, tritt ab 20 Uhr Joanna Stanecka auf, begleitet von Zibby Krebs (Gitarre). Ihr Repertoire für diesen Abend gehört der polnischen Schriftstellerin, Dichterin und Songtexterin Agnieszka Osiecka. Wer die Musik nicht kennt, dem helfen sicher die Stichworte, die die Wahl-Ratingerin nennt: „Osieckas Texte berühren die wichtigsten Themen: Liebe, Freundschaft, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit und das Bedürfnis nach Kontakt mit der Natur. Aber sie enthalten auch eine große Portion Humor und sind ein bisschen Hippie.“
Das Begleitprogramm der aktuellen Sonderausstellung des Oberschlesischen Landesmuseums „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ mit sechs Vorträgen im Jahr 2023 zu europäischen Konflikten von der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart startet am 26. Februar um 15 Uhr mit einem Impulsvortrag von Dr. Thorsten Gromes vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Unter dem Titel „Friedensstrategien für ethno-nationalistische Konflikte“ wird das Für und Wider prominenter Konzepte zur Befriedung ethno-nationalistischer Konflikte, darunter Demokratisierung, Machtteilung und räumliche Trennung der Gruppen erörtert. Der Eintritt ist frei. Vor dem Vortrag, um 13:30 Uhr, führt der Museumsdirektor und Ko-Kurator Dr. David Skrabania die Besucherinnen und Besucher durch die Sonderschau. Die Ausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ (bis 31. Dezember 2023) thematisiert die Geschehnisse zwischen 1922–1939 in Oberschlesien, als die Region zwischen Deutschland und Polen geteilt war und sich die Bevölkerung auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene vor immense Herausforderungen gestellt sah. Oberschlesien galt zu jener Zeit als Modellregion für den Minderheitenschutz und die Sicherung von Minderheitenrechten. Im Rahmenprogramm und bei Führungen werden zudem Autonomiebestrebungen und Separationstendenzen in Europa (Krieg in der Ukraine, Konflikte auf dem Balkan, in Georgien, Berg-Karabach oder Republik Moldau; beigelegte bzw. beruhigte Konflikte in Nordirland, im Baskenland, in Katalonien oder Schottland) behandelt und diskutiert. Dr. Thorsten Gromes ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Friedensprozesse, Nachbürgerkriegsgesellschaften und sogenannte humanitäre militärische Interventionen. Lange Zeit verfolgte er intensiv die Konflikte in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens.
Zu einem Neujahrsempfang und einer Vernissage fanden sich am vergangenen Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Haus Oberschlesien ein. „Es ist ein gelungenes Comeback des Veranstaltungsformats Neujahrsempfang – so der Vorsitzende der Stiftung Haus Oberschlesien, Sebastian Wladarz. Daran schloss sich sein Dank an die zahlreichen Anwesenden, die Mitwirkenden und das Team des Oberschlesischen Landesmuseums an. Eine Zusammenfassung der laufenden Projekte und ein Ausblick auf die geplanten Vorhaben durch den Museumsdirektor Dr. David Skrabania rundeten die Veranstaltung ab.
Neben der Fotoausstellung „Arbeitersiedlungen an der Seidenstraße“ des Düsseldorfer Fotografen Bernard Langerock, die noch bis zum 5. März zu sehen ist, und „Jüdische Spuren. Von der Synagoge zum Gebetshaus in Beuthen“, unterstrich Skrabania die Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ (beide bis 31. Dezember). Die letztgenannte wird von einem umfangreichen Begleitprogramm mit sechs Vorträgen zu europäischen Konflikten der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart begleitet, das am 26. Februar mit dem Vortrag von Dr. Thorsten Gromes vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung über „Friedensstrategien für ethno-nationalistische Konflikte“ eingeleitet und am 10. Dezember mit dem Vortrag von Dr. Lutz Schrader vom Institut Frieden und Demokratie der FernUniversität in Hagen endet. Darüber hinaus werden sich vier weitere Experten mit spezifischen Konfliktregionen auseinandersetzen, die Genese der Konflikte beleuchten und Lösungsansätze aufzeigen, darunter am 27. April Prof. Dr. Kerstin Jobst von der Universität Wien mit dem Vortag über „Nationsbildung mittels Konflikt? Die ukrainischen Gebiete zwischen 1772 bis 2022“. „Sie sehen, wir braten nicht nur im eigenen Saft, sondern betrachten unsere Bezugsregion als Modellregion für gesellschaftliche Prozesse, die europaweit von Bedeutung sind“ – bekräftigte der Museumsleiter. Er kündigte auch die von einer Podiumsdiskussion begleitende Eröffnung der Ausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ am 26. März an, zu der hochrangige Gäste wie der Kulturreferent für Russlanddeutsche, Edwin Warkentin, der Landesvorsitzender Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (Landesgruppe Nordrhein-Westfalen), Dietmar Schulmeister sowie die Publizistin Irina Peter und ein Grußwort der Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Natalie Pawlik, erwartet werden. „Das Oberschlesische Landesmuseum sieht sich im Kontext des Krieges in der Ukraine und der in Deutschland geführten öffentlichen Debatten in der Verantwortung, die Thematik auf vielschichtige Art und Weise aufzugreifen und ihr ein Forum zu geben, einerseits um auf das Unrecht der russischen Angriffskrieges hinzuweisen, andererseits um Missverständnisse und Vorurteile, denen gegenüber sich die russlanddeutsche Community konfrontiert sieht, auszuräumen und das Verständnis für die schwierige Geschichte der Deutschen aus Russland zu heben“ – betonte Skrabania. Eine weitere Ausstellung – zur preußischen Militärkultur in Schlesien in der Friedenszeit zwischen der Gründung des Deutschen Reiches und dem Ersten Weltkrieg – startet im Oktober. Das deutsch-polnische Projekt mit unikalen Leihgaben des polnischen Sammlers Norbert Kozioł stellt das kulturelle, soziale und wirtschaftliche Leben schlesischer Garnisonsstädte in den Vordergrund und beleuchtet kritisch den immer weiter fortschreitenden preußischen Militarismus dieser Zeit. Nicht zuletzt, weil es Termine gibt, die möglichst früh im Kalender stehen sollten, verwies der Museumschef auf das Sommerfest am 17. Juni mit Live-Musik, Workshops und Museumsführungen. Ferner werden die bewährten Veranstaltungsformate: Salon Silesia, Podium Silesia und Litterae Silesiae sowie die Höseler Gespräche – Aktuelle Beiträge zu Politik und Gesellschaft fortgesetzt. Anfang Juni beherbergt die Stiftung Haus Oberschlesien eine internationale wissenschaftliche Konferenz zum Thema „Konkurrierende Grenzräume im historischen Vergleich. Die Rheinprovinz und die Provinz Oberschlesien nach dem Ersten Weltkrieg“. Ende Oktober wiederum das Schlesien-Kolloquium. Die inhaltliche Vermittlung rund um Oberschlesien wird ergänzt durch die museumspädagogischen Workshops der Reihe MACHBAR und mittlerweile zwei Escape Rooms. Im Hintergrund wird in den Bereichen Dokumentation und Digitalisierung des Archiv- und Bibliotheksbestandes geforscht.
Im Oktogon des Haus Oberschlesien erstrahlte am Sonntag, den 29. Januar aber auch die Kunst der aus Polen stammenden Krefelderin Mauga Houba-Hausherr. „Die Ausstellung passt in vielerlei Hinsicht zu uns“, begann Dr. Frank Mäuer seine Ansprache, „thematisch, biografisch und aufgrund der Unterstützung durch das Land NRW auch institutionell“. Sie zeugt von einer Kontinuität, die bereits mit einer Ausstellung unter Beteiligung der Künstlerin im Jahr 2016 begann und nun in einer Einzelausstellung mündet. „Es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen dem Haus und der präsentierten Kunst – es ist die Intensität, mit der man sich den Themen und der Malerei nähert“ – fügt die Pressesprecherin, Katarzyna Lorenc hinzu.
Ein doppelter Anlass – Neujahrsempfang und Ausstellungseröffnung von „Zwei Mal Heimat – An Rhein und Oder. Acrylmalerei von Mauga Houba-Hausherr“ – lockt am Sonntag, 29. Januar 2023, zwischen 14 und 16 Uhr ins Haus Oberschlesien (Bahnhofstraße 71, Ratingen). In einer Einzelschau präsentiert die aus Polen stammende Krefelderin ein Dutzend neuester Bilder aus einer Werkreihe. Die skizzenhaften Groß- und Mittelformate sind im vergangenen Jahr im Rahmen eines Stipendienprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen an den beiden Flüssen Oder und Rhein entstanden. Zu sehen ist von leuchtenden Farben durchflutete Landschaftsmalerei, die vor Ort, in der freien Natur, geschaffen wurde und dem Motiv selbst, dem Fluss und den von ihm durchzogenen Weiten Reverenz erweist. Die präsentierten Werke sind ein „Sinnbild für das Kommen und Gehen, für all das, was dadurch erst wird und auch wieder vergeht, für das Ufer als Barriere, die gleichwohl überwunden werden kann, als Ort der Trennung und Verbindung zugleich“. Neben dem ästhetischen Genuss bietet der Neujahrsempfang die Gelegenheit, die Vielzahl der geplanten Veranstaltungen des Oberschlesischen Landesmuseums für das gerade begonnene Jahr aufzuzeigen, das Museumsteam kennen zu lernen und ins Gespräch zu kommen. Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Eröffnung genau auf den 60. Geburtstag der Künstlerin fällt und als Anlass genommen werden kann, ihr zu gratulieren. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Ausstellung ist bis zum 31. Dezember 2023 auf Anfrage während der Öffnungszeiten des Oberschlesischen Landesmuseums zu sehen.
Mauga Houba-Hausherr wurde 1963 in Kattowitz geboren. Sie absolvierte ein Designstudium an der Hochschule Niederrhein und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Sie lebt und arbeitet zwischen Krefeld und Biestrzynnik (Oberschlesien).
Im Jahr 2023 feiert ein Kulturpartner des Oberschlesischen Landesmuseums sein 25-jähriges Bestehen: Der Ratinger Kammerchor – ein Meisterchor im Chorverband NRW – hat sich der Pflege der weltlichen und geistlichen Chormusik für kleinere Besetzungen verschrieben. Ein besonderes Anliegen des Chores ist es, weniger bekannte und gesungene Komponistinnen und Komponisten der Öffentlichkeit vorzustellen. Das diesjährige Programm des Chores ist der Komponistin Felicitas Kukuck (1914-2001) gewidmet. Der Gesang spielte im Leben der Hamburgerin mit schlesischen Wurzeln eine zentrale Rolle. Vom Kanon bis zum Oratorium komponierte sie zahlreiche Werke geistlicher und weltlicher Vokalmusik, hinterließ aber auch ein umfangreiches instrumentales Oeuvre. Ihre Leidenschaft galt vor allem der Laienmusik. Sie war als Volkshochschullehrerin tätig, leitete einen Fidelkreis und gestaltete ein Schulmusikprogramm für Radio Bremen. 1967 gründete Kukuck den Kammerchor Blankenese, mit dem sie viele ihrer Werke uraufführte. Ihre Musik steht in der Tradition der Gebrauchs- und Laienmusik ihres Lehrers Paul Hindemith (1896-1963), die nach dem Krieg lange im Schatten der musikalischen Avantgarde stand.
Im Jubiläumsjahr ehrt der Ratinger Kammerchor unter der Leitung von Dominikus Burghardt die Komponistin Felicitas Kukuck mit einem siebenteiligen Konzertzyklus. Die Eröffnungsmatinée findet am Sonntag, 22. Januar 2023, von 11 bis 13 Uhr im Oberschlesischen Landesmuseum statt. Für den musikalischen Auftakt sorgt das Ratinger Blechbläserensemble. Zum Leben und Werk Kukucks referiert die Tochter der Komponistin Dr. Margret Johannsen. Der Eintritt ist frei. Eingerahmt wird der Ratinger „Felicitas-Kukuck-Zyklus“ von einer ganzjährigen, der Komponistin gewidmeten Präsentation im Oberschlesischen Landesmuseum.
Am Freitag, den 20. Januar, stellt die in Berlin lebende Karolina Kuszyk in einer moderierten Lesung im Oberschlesischen Landesmuseum ihr Debüt vor, das 2019 auf Polnisch unter dem Titel „Poniemieckie“ und im Oktober 2022 auf Deutsch als „In den Häusern der anderen“ (in der Übersetzung von Bernhard Hartmann) erschienen ist.
Es ist in erster Linie eine Geschichte von Menschen, die sich das Vorgefundene, das am Ende des Zweiten Weltkrieges von Millionen Deutschen zurückgelassen werden musste, zu eigen machten. Anschaulich schreibt Karolina Kuszyk darüber, wie sich der Blick auf Alltagsgegenstände verändern kann, wie fremde „Souvenirs“ zu eigenen werden können. Das Buch dient als eine Klammer zwischen dem sich wandelnden Verhältnis, das ein Mensch zum Materiellen haben kann – zwischen dem Wunsch, alles ehemals Deutsche aus dem Haushalt und der umgebenden Landschaft zu tilgen, über eine pragmatische Entscheidung der Weiterverwendung bis hin zu einer kulturellen Anerkennung und Aufwertung, einer Form des Hypes, der die Menschen wie eine Triebfeder auf die Flohmärkte und Schlösser bringt. Darüber hinaus zeigt die Publikation eindringlich, wie fragil das kulturelle Gedächtnis gerade in historisch gewandelten Regionen sein kann. Dabei positioniert sich die Autorin für das Neue, das kommt, aber auch für die Pflege des Gewesenen. Auf fast 400 Seiten überzeugt die Autorin mit einem multiperspektivischen Blick, verdichtet aus Querverweisen auf Geschichts-, Sozial-, Kultur- und Literaturwissenschaften, und zeigt überzeugend, dass diesem Debüt eine profunde Recherche, ein unglaubliches Wissen und innige Beobachtungsgabe, zugrunde liegen. Die zum Teil chronologisch aufeinander aufbauenden Kapitel erzählen eine globale und lokale Geschichte von glücklicherweise nur teilweise unwiederbringlich verlorenen Objekten. Kuszyk beweist, dass sich unser Bild von der Welt ständig weiterentwickelt. Die Art und Weise, wie wir sie betrachten, wandelt und wächst. Dabei spielen äußere Bedingungen eine Rolle, darunter historische Erfahrungen sowie kulturelle und soziale Hintergründe. „In den Häusern der anderen“, das schon in vierter Auflage vorliegt, ist eine Erzählung über materielles Gefüge (mit immateriellen Kern) und eine wunderbare Grundlage für eine Debatte, für die die Zeit reif ist – nach der aktuellen Resonanz und den Bestsellerzahlen zu urteilen.
Die Lesung findet am Freitag, den 20. Januar im Rahmen von Litterae Silesiae im Haus Oberschlesien (Bahnhofstraße 71, 40883 Ratingen) statt und beginnt um 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das gegenüberliegende Oberschlesische Landesmuseum ist an diesem Tag bis 18:30 Uhr geöffnet. Das Buch „In den Häusern der anderen“ kann im Voraus im Museum sowie vor und nach der Lesung erworben werden (solange der Vorrat reicht). Einen Tag später ist die Autorin im Bochumer ZEITMAULtheater anzutreffen.
Vom 12. bis 14. Januar 2023 besucht eine Delegation von Vertretern der polnischen Stiftung Ukraina (Fundacja Ukraina) und des Instituts für die Rechte von Migranten (Instytut Praw Migrantów) mit Sitz in der niederschlesischen Stadt Breslau (Wrocław) Nordrhein-Westfalen. Ein Besuch im Oberschlesischen Landesmuseum durfte dabei nicht fehlen. Ziel der Reise von Bartłomiej Potocki, Karol Korczyński und Mariia Kobytska im Rahmen des Projekts „Brücken bauen 4Ukraine“, das in Partnerschaft mit Info-Forum-Polregio unter der Leitung von Joanna Szymańska entwickelt wurde, war die Vernetzung und Knüpfung von Kontakten zwischen polnischen und deutschen Organisationen und Institutionen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Frage nach bewährten Ansätzen der Vermittlungsarbeit für und mit Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Katarzyna Lorenc, die im Museum für Kommunikation und Marketing zuständig und seit Januar 2020 Mitglied des Essener Integrationsrates ist, führte die Gäste durch die Sonderausstellungen und stellte die Escape Rooms vor, die aufgrund der Identität der Region dreisprachig deutsch-polnisch-schlesisch konzipiert sind. Sie wies auch auf das Begleitprogramm der Ausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ hin, das sich ab dem 26. Februar explizit mit Friedensstrategien für ethno-nationalistische Konflikte, nicht nur in Oberschlesien, beschäftigt. Das Museum versteht sich als gutes Beispiel für den Dialog und die mehrsprachige kulturelle Teilhabe. So findet am 21. Februar um 16 Uhr – anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache – eine kostenfreie Führung in deutscher und polnischer Sprache durch die Ausstellung „Arbeitersiedlungen an der Seidenstraße. Fotoausstellung von Bernard Langerock“ statt.
Heute, am 13. Januar, kommen die polnischen Gäste mit Tayfun Keltek, dem Vorsitzenden des Landesintegrationsrates, Tim Kurzbach, dem Oberbürgermeister von Solingen, und Anita Dabrowski, der Leiterin der Caritas-Begegnungsstätte Wuppertal/Solingen, zusammen.
Auch im Jahr 2023 setzt das Oberschlesische Landesmuseum auf Vielfalt, sowohl inhaltlich als auch bei den Vermittlungsformaten. Das soeben erschienene Quartalsprogramm für den Zeitraum Januar – März 2023 avisiert eine Künstlerführung mit Bernard Langerock durch seine Sonderausstellung „Arbeitersiedlungen entlang der Seidenstraße“ (15.1., 15 Uhr), eine Autorinlesung von und mit Karolina Kuszyk (20.1., 18:30 Uhr), verschiedene Mitmach-Workshops für Jung und Alt, in denen unter anderem Zuckermalerei (21.1., 14 Uhr) und Handlettering (19.3., 15 Uhr) erprobt werden können, eine Matinée zu Ehren der deutschen Komponistin Felicitas Kukuck in Kooperation mit dem Ratinger Kammerchor (22.1., 11 Uhr), die Vernissage der Einzelausstellung mit Acrylmalerei von Mauga Houba-Hausherr (29.1., 14 Uhr), Führungen in deutscher und polnischer Sprache anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache (21.2., 16 Uhr), einen Vortrag des Friedens- und Konfliktforschers Dr. Thorsten Gromes zu Friedensstrategien für ethno-nationalistische Konflikte (26.2., 15 Uhr) sowie öffentliche Kuratorenführungen durch „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“ in Zusammenarbeit mit der VHS Ratingen. Das erste Quartal 2023 endet mit der Eröffnung der Wanderausstellung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland unter dem Titel „Deutsche aus Russland – Gestern und Heute“, die sich mit den Schicksalswegen, der Geschichte und den Kriegsfolgen der Russlanddeutschen befasst. Das Museum hat viel vor und setzt auf Vielschichtigkeit und Zusammenwirken. Wer im persönlichen Austausch mit dem Museumsteam Näheres erfahren möchte, findet sich beim Neujahrsempfang am 29.1. ab 14 Uhr im Haus Oberschlesien (Bahnhofstraße 71, Ratingen-Hösel) ein. Dort wird dann das Programm im Detail vorgestellt. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Website des Museums unter www.oslm.de